Südtirol unterscheidet sich in mancher Hinsicht von seinen Nachbarregionen. Eine unserer Eigenheiten ist die ethnische Differenzierung, doch die soziale und ökonomische Ungleichheit gibt es bei uns genauso. Wie hängt die Zugehörigkeit zu einer der autochthonen Sprachgruppen oder zur Gruppe der Zuwanderer mit Bildung, Einkommen, Vermögen, Berufstätigkeit und anderen zentralen Aspekten der Sozialstruktur zusammen? Klafft auch in Südtirol die Schere zwischen privilegierten und Benachteiligten in Bezug auf Lebensstandard, Bildungschancen, Berufs- und Karrieremöglichkeiten, Mitbestimmungsrechten usw. zunehmend auseinander? Wie wird die soziale Schichtung in der Südtiroler Gesellschaft durch die Verteilung auf drei Sprachgruppen beeinflusst?
Solchen grundlegenden Fragen geht ein Sammelband nach, der zu den wichtigsten Publikationen gehört, die 2016 zu Südtirol erschienen sind. Es geht um die umfassende sozialwissenschaftliche Analyse und Darstellung der Südtiroler Gesellschaft mit ihren strukturellen Besonderheiten, unter spezieller Berücksichtigung ihrer ethnischen Zusammensetzung. Themen sind nicht nur objektive Sachverhalte wie die Ungleichheit bei Bildung, Einkommen, Vermögensverhältnisse, Reproduktionsarbeit, Familienformen. Thema ist auch die subjektive Einschätzung der eigenen Lebenslage und Schichtzugehörigkeit.
Die zentrale empirische Grundlage der Studie war eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zu einem breiten Spektrum an Fragestellungen. 1.200 Haushalte mit 3.500 Mitgliedern haben sich daran beteiligt. Das Forschungsprojekt ist von der Michael-Gaismair-Gesellschaft und dem Institut Apollis unter der Federführung der Professoren Günther Pallaver, Max Haller, Max Preglau, Antonio Scaglia sowie Apollis-Leiter Hermann Atz betreut worden. Ein zehnköpfiges Wissenschaftlerteam aus Soziologie, Wirtschafts- und Politikwissenschaft hat drei Jahre daran gearbeitet. Das Ergebnis ist eine fundierte Reflexion über die besondere soziale Struktur und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung: »In erster Linie geht’s darum,« schreibt Herausgeber Hermann Atz, »das Potenzial und die Gefahren für eine ethnisch stark diversifizierte Gesellschaft aufzuzeigen.« Für die Südtiroler Sozialforschung ist damit ein Grundlagenwerk entstanden. Keine leichte Kost, doch für das Verständnis der Südtiroler Gesellschaft heute ein Muss.
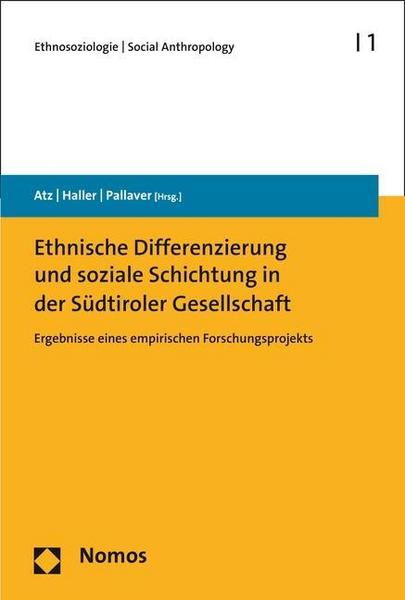 Hermann Atz, Max Haller, Günther Pallaver (Hrsg.)
Hermann Atz, Max Haller, Günther Pallaver (Hrsg.)
Ethnische Differenzierung und soziale Schichtung in der Südtiroler Gesellschaft
Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojekts
2016, 407 S., brosch., 79 Euro
ISBN 978-3-8487-3329-3
Mit Beiträgen von: Hermann Atz, Max Haller, Günther Pallaver, Thomas Benedikter, Saskia Buiting, Romana Lindemann, Erika Pircher, Eike Pokriefke, Max Preglau, Antonio Scaglia.

Scrì na resposta