»Gemeinsam einsam« ist ein Beitrag der NZZ-Romkorrespondentin Andrea Spalinger über Südtirol vom 16. Juni betitelt und bringt eine Reihe alter Märchen über unser Land. Einige Kostproben:
Vor wenigen Jahrzehnten herrschten in Südtirol noch bürgerkriegsähnliche Zustände
Wahr ist: es gab Attentate gegen Einrichtungen des Staates, Angriffe gegen Polizei und Militär, doch es gab in Südtirol nie eine verbreitete Gewalt zwischen italienischer und deutscher Zivilbevölkerung. In Südtirol herrschte in den 1960er Jahren genau so wenig »Bürgerkrieg« wie im Schweizer Jura in den 1970er Jahren.
Trotz obligatorischer Zweisprachigkeit beherrschen laut Studien die meisten Südtiroler die andere Sprache nur ungenügend
In zweifacher Hinsicht ein Unsinn: Weder ist es bei uns Pflicht, zweisprachig zu sein (gibt es das etwa in der Schweiz?), noch sind die Zweitsprachkenntnisse der Südtirol aller Sprachgruppen so schlecht. 75% der Deutschen können laut Astat gut oder sehr gut Italienisch, fast 40% der Italiener können sehr gut oder gut Deutsch. Spalinger hat sich die wichtigste Studie in diesem Bereich eben nicht angeschaut (Astat-Sprachbarometer 2014).
Die deutsche Rechtsopposition stellt nicht ein Drittel des Landtags, sondern 10 von 35 Abgeordneten. Diese landläufig als »patriotisch« bezeichneten Parteien als »Ewiggestrige« zu bezeichnen, rückt sie in gewissen Sinn schon in die Nähe der NPD oder von CasaPound. Gegenfrage an Spalinger: Bezeichnen Sie die Schweizer SVP und ähnliche Schweizer Gruppen auch als Ewiggestrige? Unabhängig von der jeweiligen Position zur Selbstbestimmung: Ist Eintreten für Selbstbestimmung »ewiggestrig«?
In ihrer Nachzeichnung des Südtiroler Wegs zur Autonomie unterscheidet Spalinger zudem nicht zwischen der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen, eine grobe Unterlassung. Überdies fließen schon länger nicht mehr 90% der Steuereinnahmen wieder zurück ins Land, vielmehr sind es seit dem Sicherungspakt 2014 nur noch rund 75%.
Journalistisch unkorrekt und sachlich falsch ist dann folgende Einschätzung: Rom sei irritiert darüber, »dass die gewährten Privilegien von den Südtirolern nicht gebührend geschätzt werden und die Autonomie in gewissen Kreisen immer noch umstritten ist«. Richtig ist: Weder ist die Errichtung einer Autonomie ein Privileg, sondern vielmehr eine völkerrechtliche Verpflichtung Italiens, noch ist die Autonomie in diesem Sinn umstritten. Fast alle deutsch- und ladinischsprachigen politischen Kräfte (und auch das Trentino) betrachten die heutige Autonomie als unzureichend, weshalb vor einem halben Jahr ein institutioneller Reformprozess gestartet worden ist. Hat Spalinger das überhaupt nicht mitbekommen?
Florian Kronbichler als ersten und einzigen Nicht-SVP-Vertreter Südtirols zu bezeichnen, bestätigt die Oberflächlichkeit einer Journalistin, die nur mit Vertretern der Grünen sowie mit den beiden Journalisten Georg Mair (ff) und Gabriele Di Luca gesprochen hat. Nicht nur sitzen heute Politiker anderer Couleur im Parlament (sind Palermo, Gnecchi usw. keine »Vertreter Südtirols«?), auch früher schon gab es Südtiroler Oppositionelle im Parlament (z.B. Gianni Lanzinger).
Quelle: Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
Ein in Südtirol hartnäckiger Topos ist schließlich jener der Trennung durch separate Schulen:
Aus Angst vor Italianisierung hat man danach auch Schutz durch Trennung gesetzt. Deutsch- und italienischsprachige Südtiroler besuchen vom Kindergarten bis zur Matura separate Schulen.
Hier zitiert die Autorin Spalinger Gabriele Di Luca, aber bei »Schutz durch Trennung« müssen auch in der Schweiz weniger Informierte an eine Art Apartheid denken. Wo bitte erklärt Spalinger der NZZ-Leserschaft das Südtiroler Sprachgruppenprinzip? Warum schreibt sie nicht, dass in Südtirol seit 70 Jahren das Recht auf eigenständige Schulen in den jeweiligen Muttersprachen ein Grundpfeiler des Minderheitenschutzes ist?
Aus Schutz vor Germanisierung haben die Tessiner eine italienischsprachige Schule?
Hat Spalinger jemals das Tessiner Schulsystem so beschrieben?
Auch in der Schweiz gilt überall, auch in den zweisprachigen Kantonen wie Freiburg und Wallis, der jeweilige Vorrang der Kantonssprache oder Kantonsteilsprache in der obligatorischen Schulbildung. Sind die Walliser deshalb »gespalten« oder getrennt?
Eine direkte Frage an Andrea Spalinger zum Abschluss, weil sie Südtirol so »gespalten« sieht: Ist die Schweiz in vier Sprachgruppen »gespalten«? Sorry, aber gerade von der NZZ hätte ich mir etwas mehr Sorgfalt in Recherche und Urteil erwartet.
Cëla enghe: 01

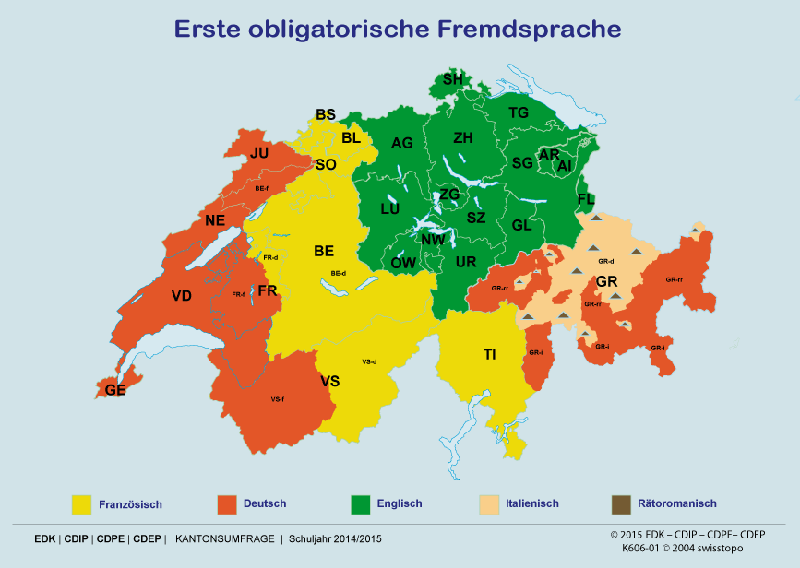
Scrì na resposta