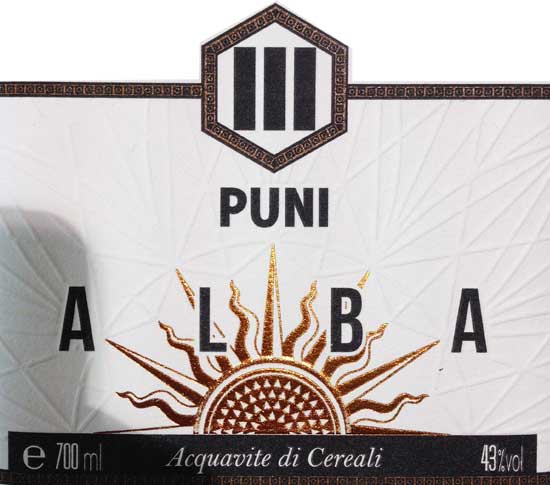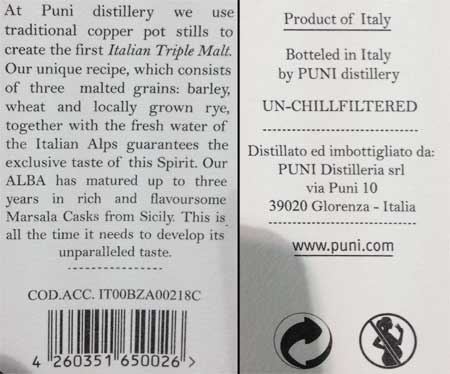Das nun beginnende Jahr 2014 wird ein Jahr voller Symbolgehalt sein. Es wird das 300. Jubiläum des Erbfolgekriegs von 1714 sein, als Katalonien seine Privilegien, seine Verfassung, seine Institutionen und seine Freiheiten verlor. Drei Jahrhunderte später stehen wir beinahe vor einem Wunder: Ein Volk, das in dieser Zeit ebenso gut hätte verschwinden können, setzt nicht nur seine Existenz fort, sondern plant — stärker denn je — eine große demokratische und vollkommen freidliche Herausforderung zu meistern, indem es über seine Zukunft als Land, als Staat, als Volk entscheidet.
Katalonien ist ein vielfältiges und multikulturelles Land, wegen der Herkunft der Menschen, die hier leben, wegen der Sprachen, die hier gesprochen werden, wegen der unterschiedlichen Denkungsarten und aufgrund der Vielfalt der politischen und ideologischen Optionen.
Ein vielfältiges und multikulturelles Land, welches gleichzeitig fähig ist, großen Konsens aufzubauen, wie er vor wenigen Wochen sichtbar wurde, als das Abkommen für ein Referendum unterzeichnet wurde, welches am 9. November dieses neuen Jahres stattfinden soll.
Ich weiß, dass es zu dieser großen Herausforderung keine Einstimmigkeit gibt. Manche Parteien widersetzen sich ihr, manche Mitbürger begegnen dem Prozess mit Sorge, Angst und sogar Ablehnung.
Das sind legitime und respektable Positionen, genauso legitim und respektabel, wie die, die in diesem Prozess den besten Weg zum Aufbau eines neuen Staates sehen: wegen seiner Modernität, dem Wohlstand, dem Sinn für soziale Gerechtigkeit, der gesellschaftlichen Verantwortung und der demokratischen Qualität.
Jede einzelne Position muss mit Respekt und im Geiste des gemeinsamen Fortschritts verteidigt werden. Und soweit das von mir abhängt, wird es so sein.
Über die individuelle Ansicht eines jeden einzelnen von uns hinaus werden es die Stimmen in den Urnen sein, die über Proportion und Außmaß der [politischen] Mehr- und Minderheiten in diesem Land entscheiden.
Es gibt nichts Demokratischeres als diesen Weg. Katalonien ist ein Land mit einer langjährigen und tiefen demokratischen Überzeugung, weshalb wir diesen Weg beschreiten. Wichtige Themen demokratisch zu lösen sollte weder Bestürzung noch Angst hervorrufen, und es ist selbstverständlich, dass unsere Zukunft und das Verhältnis zu Spanien und Europa zu den wichtigsten unserer Herausforderungen gehören.
Ich möchte diese Neujahrsansprache nutzen, um den spanischen Staat dazu aufzufordern, uns abstimmen zu lassen. Möge er die Stimme des katalanischen Volkes hören und keine Mauern errichten, um uns verstummen zu lassen. Diejenigen, die das Bedürfnis dazu verspüren, sollen entscheiden dürfen.
Jedes Land hat implizit das Recht, über seine Zukunft zu entscheiden. Doch jenen, die sogar diese Selbstverständlichkeit ablehnen, werde ich sagen, dass sich Katalonien sein Recht auf Selbstbestmmung verdient hat. Die Katalanen in Vergangenheit und Gegenwart haben das Recht auf Selbstbestimmung erworben, weil sie es verstanden haben, ihre Identität, ihre Kultur, ihre Sprache und ihre Rechte am Leben zu erhalten, häufig gegen unrechte Gesetze und Normen; sie haben das Recht auf Selbstbestimmung erworben, weil sie Millionen von Menschen aus spanischen Regionen und fernen Ländern willkommen geheißen und integriert haben, wobei sie bewiesen haben, dass in Katalonien das gemeinsame Ziel wichtiger ist, als die Herkunft; und, vor allem, haben die Katalanen das Recht auf Selbstbestimmung erworben, da sie es verstanden und darauf bestanden haben, ihren Willen auf Eigenregierung aufrecht zu erhalten, unabhängig von historischen Widrigkeiten, die diese Eigenregierung aufhalten wollten und die sie jetzt einschränken und mindern möchten.
Mit einem Wort ziehen es die Katalanen vor, sich selbst zu regieren, statt regiert zu werden. Und sie wollen dies in einem stärkeren, geeinteren, föderaleren Europa tun.
Deshalb erheben wir den Anspruch, abstimmen zu dürfen und von der spanischen Regierung nicht als Gegner, geschweige denn als Feinde, angesehen zu werden. Wir waren und wir wollen jetzt und in Zukunft Partner sein, gute Partner. Aber von einer Position der Freiheit, unseres eigenen freien Willens aus — indem wir die Frage beantworten, für die wir eine Formulierung und ein Datum vereinbart haben.
2014 wird also ein Jahr sein, während dessen wir uns an die Geschichte, Menschen und Wurzeln erinnern werden; doch es wird auch ein Jahr, um über die Zukunft zu entscheiden und Horizonte zu erweitern.
[…]
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Staat, den viele für Katalonien fordern, wie jeder andere Staat, nichts mehr als ein Werkzeug im Dienste der Menschen und des Landes ist. Das heißt, seiner Bürger.