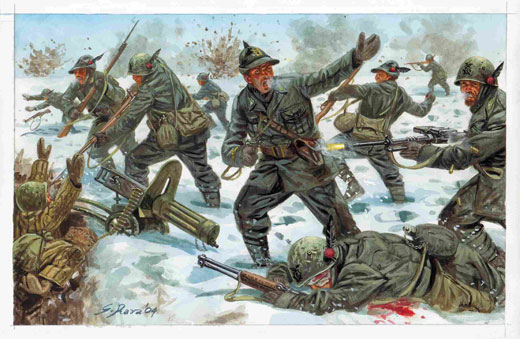In der dieswöchigen ff (Nr. 19 vom 9. Mai 2013) ist ein leider erschreckend oberflächlicher Leitartikel zum Thema Selbstbestimmung erschienen, wie wir ihn schon länger nicht mehr lesen mussten. Ein Kommentar.
Die Falle Selbstbestimmung
von Georg Mair
Selbstbestimmung ist möglich, sagt ein Gutachten eines Innsbrucker Universitätsprofessors.
Angeblich stimmt das nicht, Prof. Hilpold hat der Auslegung seines Gutachtens durch die Süd-Tiroler Freiheit (STF) widersprochen — aber das wusste Mair bei Redaktionsschluss vermutlich noch nicht.
Ja, und was folgt daraus? Ist sie ein Schritt nach vorne, ein Schritt in die Vergangenheit?
Daraus würde erstmal noch gar nichts folgen, die Selbstbestimmung als solche ist neutral und kann für einen Schritt nach vorne, einen Schritt in die Vergangenheit und sogar für die Beibehaltung des Istzustandes genutzt werden. Wobei eher unwahrscheinlich ist, dass sich die Südtiroler mehrheitlich für einen Rückschritt entscheiden würden.
Wenn Sven Knoll, Landtagsabgeordneter der Süd-Tiroler Freiheit, von Selbstbestimmung redet, dann glüht er. Wenn es um Selbstbestimmung geht, kennt die Süd-Tiroler Freiheit nur Freunde – dann ist es mehr oder weniger egal, was jemand für Gesinnung hat. Der Ruf nach Selbstbestimmung ist die Existenzgrundlage dieser Partei, die meint, Südtirol sei eine Kolonie Italiens.
Meint sie dies? Mag sein, ich kann es schwer beurteilen und will nicht den Advocatus für eine Partei spielen, die meiner Meinung nach auch viele Fehler macht. Von einer Einzelpartei auf die Selbstbestimmung zu schließen, führt aber nirgendwohin — genauso, wie der direkte Schluss von den Grünen auf den Umweltschutz unsinnig wäre.
Die Süd-Tiroler Freiheit geht ja davon aus, dass wir in einer Quasi-Diktatur leben, dabei garantiert ja gerade dieser Staat das Recht der Separatisten, sich gegen diesen Staat auszusprechen, schützt die italienische Polizei die Protestmärsche der Schützen vor Übergriffen, ermöglicht, dass sie ihr “Los von Italien” martialisch durch Bozen tragen.
Das wird von Unabhängigkeitsgegnern immer wieder als besondere Leistung ins Feld geführt, als wäre dies ein Spezifikum Italiens und nicht die Pflicht eines jeden Rechtsstaats (vgl. 01). Und als wäre die Tatsache, dass wir in einer Demokratie leben, ein Gegenargument zu einem demokratischen Entscheid — wennschon müsste doch genau das Gegenteil der Fall sein.
Selbstbestimmung möglich, verkündete die Süd-Tiroler Freiheit in dieser Woche, das habe eine Studie des Innsbrucker Universitätsprofessors Peter Hilpold ergeben. Es war auch nicht zu erwarten, dass eine Studie, in Auftrag gegeben von der Süd-Tiroler Freiheit, zu einem anderen Ergebnis kommen würde – man weiß ja schließlich, an wen man sich wenden muss, um Bestätigung zu erhalten.
Offenbar hat Mair mit dieser Aussage unrecht, wenn man berücksichtigt, dass Prof. Hilpold — wie eingangs erwähnt — der Auslegung durch die STF widersprochen hat. Selbst wenn Hilpold jedoch die Thesen der STF stützen würde, wäre es dreist, ihm einfach Voreingenommenheit (oder gar Käuflichkeit) vorzuwerfen. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass die ff Fachleuten, die gegen die Selbstbestimmung argumentieren, jemals ähnliches vorgeworfen hätte.
In der Südtiroler Politik hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten eines grundlegend geändert: Die Feinde des Autonomiestatus von 1972 werden immer stärker. Die Biancofiore meint, wir hätten zu viel davon, das Edelweiß träumt von der “Vollautonomie” (kann etwas, das schon voll ist, noch voller werden?), Alessandro Urzì ist sowieso immer dagegen, die Freiheitlichen werden bis zu den Wahlen die Idee vom “Freistaat Südtirol” wie eine Monstranz vor sich her tragen, und die Süd-Tiroler Freiheit wird für die Selbstbestimmung marschieren – am liebsten natürlich rechtsrum marsch.
- Wenn stimmt, was Mair schreibt, nämlich dass die Unzufriedenheit mit dem Status Quo stark zugenommen hat: Wäre dies nicht ein Argument, das dafür sprechen würde, die Bevölkerung (basis-)demokratisch über die Zukunft Südtirols befinden zu lassen?
- Wer sagt, dass die Autonomie schon voll ist? Wohl eher das Gegenteil ist der Fall, die Bereiche, in denen das Land primäre Zuständigkeit hat, sind wenige und wurden letzthin von Zentralregierung und Verfassungsgericht stark eingeschränkt. Selbst da, wo die primäre Zuständigkeit gilt, hat sich Südtirol dem nationalen Interesse zu unterwerfen.
Thomas Benedikter, der für  , aber auch für ff geschrieben hat, spricht sich für einen dezidierten Ausbau der Autonomie aus. Ist er, der sich selbst als überzeugter Autonomist sieht, jetzt ein Autonomiefeind?
, aber auch für ff geschrieben hat, spricht sich für einen dezidierten Ausbau der Autonomie aus. Ist er, der sich selbst als überzeugter Autonomist sieht, jetzt ein Autonomiefeind?
Wer leichtfertig eine Errungenschaft wie das zweite Autonomiestatut infrage stellt, zündelt – ob nun bewusst oder unbewusst.
Im Grunde zündeln demnach alle. Es gibt in Südtirol keine Partei, die das zweite Autonomiestatut nicht infrage stellt — um es abzuschaffen, es im Sinne der Unabhängigkeit zu überwinden oder um es durch ein drittes Statut zu ersetzen.
Er schafft Unruhe, Unfrieden zwischen den Sprachgruppen – wo sonst sollte die italienische Sprachgruppe Sicherheit – und ja: auch Heimat – finden, wenn nicht im Autonomiestatut.
Wieder ein ungebetener Advocatus der italienischen Sprachgruppe, die wohl einmal mehr nur vorgeschoben wird, um eigene Positionen zu untermauern. Dabei werden die Italiener, als gäbe es sowas Monolithisches, pietätvoll zu Unmündigen herabstilisiert, die nicht als voll ernstzunehmende Mitbürger frei mitentscheiden dürfen, sondern einen Vormund benötigen.
Das bei gutem Willen und im Konsens leicht zu reformieren oder anders auszulegen wäre, etwa was den ethnischen Proporz oder die Einführung einer mehrsprachigen Schule angeht.
Wir notieren: Die Abschaffung von Schutzmechanismen im nationalstaatlichen Kontext ist keine Zündelei, alles andere schon.
Was tun wir, wenn wir einen Freistaat haben? In Salurn Grenzpopsten aufstellen, ein Steuerparadies mitten in Europa errichten, den Südtirol-Taler statt den Euro einführen, nicht die Italiener vertreiben, aber sehr wohl die Ausländer, die bei den Freiheitlichen ohnehin unter dem Generalverdacht stehen, das Sozialsystem zu missbrauchen?
Da arbeitet Mair mit den üblichen, völlig unhaltbaren Vorurteilen und Pauschalisierungen. Steht denn am Brenner ein Grenzposten? Warum dann in Salurn? Und: Heißt es nicht immer wieder, Grenzen gebe es in Europa ohnehin gar nicht mehr?
Warum sollten die Südtiroler, wenn wir einen eigenen Staat hätten, ausländerfeindlicher sein, als heute? Die Freiheitlichen wären ja nicht automatisch Regierungspartei, eher im Gegenteil (wenn wir davon ausgehen, dass sie heute von vielen nur wegen der Unabhängigkeit gewählt werden). Menschenrechte und europäische Werte würden übrigens auch in einem unabhängigen Südtirol fortbestehen.
Was tun wir, wenn wir selbstbestimmt gewesen sein werden: die Italiener aus Südtirol vertreiben, ihnen großzügig die Rechte einer Minderheit zugestehen, uns Österreich oder der Schweiz anschließen und glücklich, aber viel ärmer leben (da bekäme das Schlagwort von der “decrescita felice” eine neue Bedeutung)?
- Die Italiener aus Südtirol vertreiben? Einen Satz weiter oben stand noch »nicht die Italiener vertreiben, aber sehr wohl die Ausländer«, jetzt hat sich’s Mair offenbar schon wieder anders überlegt. Er will halt auf gar keines der klassischen Angstargumente verzichten.
- Wie hoch wären die Chancen, dass sich ein dreisprachiges Land national definiert, die Italiener also als Minderheit behandelt würden? Warum sorgt sich niemand um die Ladiner? Wohl nur, weil sie zahlenmäßig nicht für eine Gegnerschaft zur Unabhängigkeit zu missbrauchen sind.
In jedem Fall gibt es keinen Automatismus, dass sich das unabhängige Südtirol national definieren würde. Wir ( ) etwa sprechen uns absolut gegen ein solches Modell aus, obwohl wir ebenfalls die Loslösung von Italien befürworten.
) etwa sprechen uns absolut gegen ein solches Modell aus, obwohl wir ebenfalls die Loslösung von Italien befürworten.
- Viel ärmer leben? Dieses Argument ist gleich doppelt witzig: Einmal, weil Italien gerade — anders als Österreich und die Schweiz — drastisch verarmt und uns dabei kaputtspart. Und dann, weil wirtschaftliche Argumente für die Unabhängigkeit regelmäßig als Egoismus und Mangel an Solidarität abgestempelt werden. Der Unionismus bedient sich solcher Argumente jedoch ungeniert.
Sind wir glücklicher, zufriedener, geht es uns besser, wenn wir ganz für und unter sind? Wenn wir das Fremde, das Andere abgewehrt haben? Nichts anderes ist der Ruf nach Freistaat oder Selbstbestimmung, als der Versuch, eine verlogene Idylle zu schaffen, in die Vergangenheit zu schauen anstatt nach vorne.
Schon wieder wird ein Zusammenhang hergestellt, der so nicht existiert. Ist das Festhalten am Nationalstaat und an der Autonomie (die Antwort auf Südtirols Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat) zukunftsweisend? Ist es rückwärtsgewandt, sich neue Lösungen auszudenken, die dem geeinten Europa näher stünden, zur Überwindung der Nationalstaaten beitragen, die inneren Grenzen zwischen den Sprachgruppen abbauen könnten?
Nach vorne schauen heißt Berührung, Kontamination und Konfrontation, heißt Reibung, heißt, die Berge im Kopf wegzuschieben. Selbstbestimmung ist selbstbezogen, ein Rückschritt, Selbstbestimmung gebiert neue Minderheiten.
Nein, Selbstbestimmung gebiert erstmal gar nichts, denn Südtirols Bürger könnten auch selbst bestimmen, alles so zu lassen, wie es ist. Selbst wenn sie sich dafür entscheiden würden, sich vom Nationalstaat Italien loszulösen, gebiert dies noch lange keine neuen Minderheiten. Dies wäre nur der Fall, wenn sich Südtirol nicht als dezidiert mehrsprachiges Land, das es ja ist, definieren würde, sondern als einsprachig deutsches. Dass dies so wäre, steht nirgendwo geschrieben, einen Automatismus Unabhängigkeit – neue Minderheiten gibt es so also keineswegs.
Es gibt in Südtirol keinen Grund dafür, solange wir friedlich leben, wohlhabend trotz allem, geistig selbstbestimmt, und frei, wenn wir nur wollen. Wahre Selbstbestimmung hieße, die Trennung zwischen den Sprachgruppen überwinden, Migranten integrieren, Sprachen lernen, Toleranz üben, Grenzen im Kopf verschieben, die Berge in uns überwinden.
Die Frage bleibt, ob dies eher in einem Nationalstaat aus dem 19. Jahrhundert gelingen kann, wo wir als Minderheit jeden Tag erneut beweisen müssen, »anders« zu sein — oder aber in einem neuen Südtirol, dessen Quellcode mehrsprachig ist und das sich von nichts und niemandem abgrenzen muss, um seine Autonomie zu rechtfertigen. Die Antwort von  ist bekannt.
ist bekannt.
Cëla enghe: 01 02

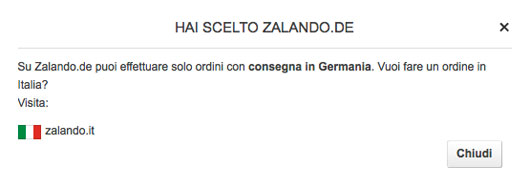
 -Sicht) auch deutliche Verschlechterungen gegeben hat, die den Text kritischer erscheinen lassen:
-Sicht) auch deutliche Verschlechterungen gegeben hat, die den Text kritischer erscheinen lassen: