Heute beschäftigt sich Arnold Tribus im TAZ-Leitartikel mit dem Thema Flagge. Stein des Anstoßes ist insbesondere, dass am Herz-Jesu-Sonntag die Schützenflagge am Völser Kirchturm hing. Im Zuge seiner Überlegungen schreibt er jedoch auch über die Staats- und die Landesflagge — und bezichtigt jene Südtiroler, die sich an der ausufernden grün-weiß-roten Beflaggung während des Alpinitreffens 2012 stießen, der Doppelzüngigkeit, da »wir« ja auch unsere weiß-roten Flaggen hissten, wenn im Land gefeiert wird.
Diese Behauptung möchte ich zum Anlass für einige grundsätzliche Überlegungen nehmen. Lassen wir dabei ruhig mal außer Acht, dass die Trikolore bei einem Militärfest eine andere Konnotation erhält, als dieselbe Trikolore bei einem (echten) Volksfest. Gehen wir stattdessen der Frage nach, ob man die Staatsflagge so ohne weiteres der Landesflagge gegenüberstellen kann. Wohl nicht: Die Trikolore repräsentiert nämlich intrinsisch die Idee eines nach nationalen Grundsätzen geeinten (und i. d. F. zentralistisch ausgerichteten) Staatsgebildes, das seinem Selbstverständnis nach grundsätzlich einsprachig, also der Fiktion von Homogenität unterworfen ist und höchstens Ausnahmen (wie Südtirol) gestattet. »Das Andere« konnte sich darin stets nur so weit behaupten, wie es sich der von der Nationalflagge repräsentierten Einflusssphäre entziehen konnte — und zwar mit mäßigem Erfolg, wenn man die allgemeine Lage der Minderheiten in diesem Staat betrachtet.
Zudem »beinhaltet« die Nationalflagge nicht die Freiheit und Gleichberechtigung der Frankoprovenzalen, der Südtiroler, der Slowenen, sondern eine unterordnende Identität als Frankoprovenzalisch, Deutsch, Ladinisch oder Slowenisch sprechende »Italiener«, worauf aus Rom in regelmäßigen Abständen — selbst von höchsten Repräsentanten der »minderheitenfreundlichen« Verfassung — aufmerksam gemacht wird.
Im Gegensatz dazu repräsentiert und fasst die rot-weiße Landesflagge unsere territoriale Realität in ihrer gesamten Komplexität zusammen. Sie ist nicht nationales Symbol der Deutschen, der Italiener oder der Ladiner, sondern inkludierendes Hoheitszeichen eines heterogenen Landes. Sie zwingt niemandem eine andere Identität auf, als die des Territoriums, in dem wir zusammenleben, wobei ihre (übrigens auch vom Nationalstaat sanktionierten) Farben nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahrhunderten für ein mehrsprachiges Land stehen. Und so, wie sie für keine (nationale etc.) Ideologie steht, repräsentiert sie auch kein Ziel (weder die Autonomie, noch die Unabhängigkeit oder die Unterordnung im Zentralstaat).
Nationales, mit der Trikolore vergleichbares Symbol der »Deutschen« wäre wennschon die schwarz-rot-goldene Flagge Deutschlands, die ebenso wie ihr grün-weiß-rotes Pendant die nationale Idee darstellt, die im jeweiligen Staat verwirklicht wurde. Selbstverständlich kommt sie hierzulande auch deshalb seltener zum Einsatz, weil sie keiner amtlichen Sphäre entspricht, der Südtirol angehört. Doch wir brauchen uns nur jene Ersatzkriege — die Fußballwelt- und -europameisterschaften — zu vergegenwärtigen, die im Zweijahresrhythmus ausbrechen, um uns die sehr reale exkludierende Bedeutung nationaler Zugehörigkeitssymbole zu vergegenwärtigen. Dann breiten sich über Südtirol die Zeichen nationaler Zuordnung aus, da dem einschließenden Landessymbol keine Mannschaft zugeordnet ist.
Man darf sich freilich gerne mit der nationalen Trikolore und der ebenso nationalen deutschen Flagge identifizieren, doch man sollte sich bewusst sein, was sie darstellen und welche Symbolwirkung sie kraft ihres ideologischen Überbaus auf viele Menschen ausüben. Freilich wäre — wie einige meinen — die gänzliche Abschaffung von Flaggen eine naheliegende Abkürzung, um den unangenehmen Folgen der Symbole zu entkommen, doch [erstens] verkennt man damit den grundsätzlichen Wert (und auch den Nutzen) von Symbolik für den Menschen und [zweitens] geht die Dekonstruktion des Repräsentierenden nicht notwendigerweise mit der Dekonstruktion des Repräsentierten einher.

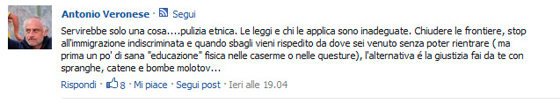
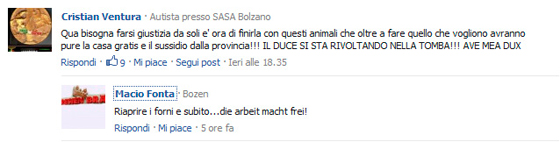

 .
.