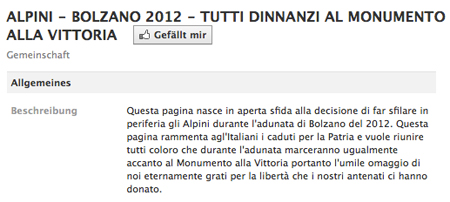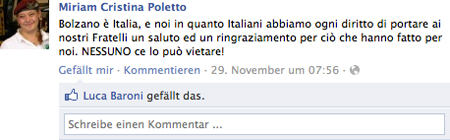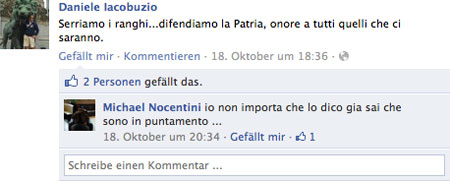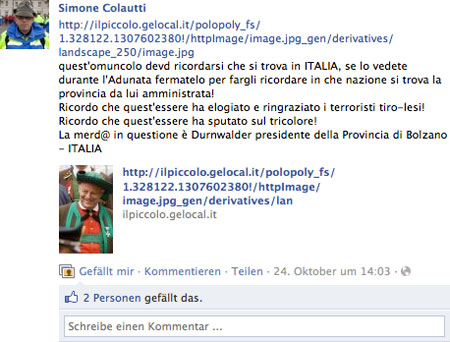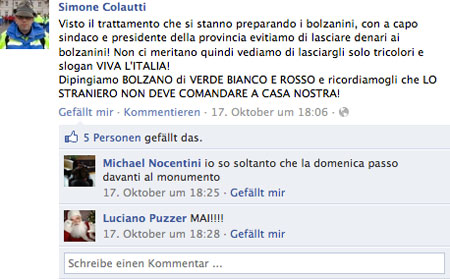Vor wenigen Tagen hat das staatliche Statistikamt (Istat) eine Studie veröffentlicht, die — wie nicht anders zu erwarten — für die kommenden Jahrzehnte eine massive Zunahme des Bevölkerungsanteils mit Migrationshintergrund prognostiziert. Auf Staatsebene soll am Ende des berücksichtigten Zeitraums (2065) jede vierte Bürgerin in einem anderen Land geboren sein. Grundsätzlich lässt sich natürlich darüber streiten, wie sinnvoll derart langfristige Vorhersagen ob ihrer wohl nicht allzu hohen Zuverlässigkeit überhaupt sind. In diesem Fall jedoch handelt es sich um eine Binsenweisheit, da realistischerweise auch ohne statistische Bestätigung von einer derartigen Entwicklung auszugehen ist.
Umso bezeichnender ist, mit welcher Pünktlichkeit sich auch in Südtirol die üblichen Scharfmacher aus dem rechten Lager auf den Plan locken lassen, um wieder einmal einschneidende Maßnahmen zu fordern. Gerade in unserem Land sei dem erstarkenden Migrationsphänomen mit größter Vorsicht zu begegnen, da die neuen Südtirolerinnen das Zeug hätten, unser gesellschaftliches Gleichgewicht zu unterminieren und die Schutzbestimmungen für die deutsche und die ladinische Sprachgruppe ad absurdum zu führen.
Nun ist zwar letzteres nicht von der Hand zu weisen, solange der Staat die primäre Gestaltungsbefugnis hat und diese so eindeutig zum Nachteil der deutschen und der ladinischen Sprache nutzt. Gerade die Rezepte, welche von Rechts an uns herangetragen werden, würden sich diesbezüglich jedoch als Bumerang erweisen: Wer im Europa der Reise- und Niederlassungsfreiheit seine Energien darauf verschwenden möchte, die Zuwanderung aufzuhalten, der ist zwar im Wettkampf der Populisten und Demagogen bestens aufgestellt — den Bürgerinnen erweist er aber einen Bärendienst.
Die Freiheitlichen etwa reden immer wieder davon, man müsse von den Fehlern lernen, die in der BRD begangen wurden und zum kläglichen Scheitern der Integrationsbemühungen geführt hätten. Dabei verschweigen sie jedoch, dass nach mittlerweile ziemlich unumstrittener Auffassung von Fachleuten (Soziologinnen, Politologinnen…) der größte Schwachpunkt des deutschen Modells war, über Jahrzehnte geleugnet zu haben, dass die Bundesrepublik überhaupt ein Zuwanderungsland ist. Aufgrund dieser Realitätsverweigerung wurde sehr viel wertvolle Zeit verloren und versäumt, den Migrantinnen durch eine positive Eingliederung in die Gesellschaft ein richtiges Heimatgefühl zu vermitteln.
Wollen wir tatsächlich von Deutschland lernen, müssen wir also genau das Gegenteil von dem tun, was uns die Rechten empfehlen. Ganz egal nämlich, ob wir die Zuwanderung begrüßen oder ablehnen: Sie wird stattfinden. Mit unserer Abwehrhaltung stünden wir dann auf völlig verlorenem Posten.
Stattdessen müssen wir vom Zentralstaat einfordern, was unser angeblich vorbildliches Autonomiestatut ganz offensichtlich nicht hergibt — nämlich die sofortige und tatsächliche Gleichberechtigung aller Landessprachen, gerade auch in diesem entscheidenden Bereich. Gleichzeitig müssen wir kurzfristig die vollständige Übernahme aller Zuständigkeiten auf diesem Gebiet anpeilen. Sobald wir sie erhalten, sollten wir sie dann jedoch nutzen, um — unter dem Vorzeichen der Gleichberechtigung und der Solidarität — allen neuen Mitbürgerinnen ein gleichermaßen würdiges Leben in ihrer neuen Heimat zu ermöglichen. Schaffen wir es, ein »inklusivistisches« Gesellschaftsmodell anzubieten und alle an dessen Mitgestaltung zu beteiligen, wird es auch im ureigensten Interesse der neuen Südtirolerinnen sein, sich in vollem Umfang um »ihr« Land und seine Besonderheiten zu bemühen und unsere gemeinsamen Regeln einzuhalten.
Cëla enghe: 01 02 03 04 05 || 01