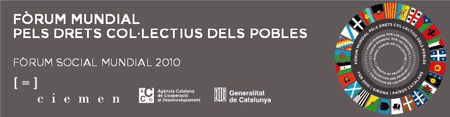I.
Glaubt man dem Landespresseamt, kann sich Südtirol kaum noch wehren vor immer neuen Kompetenzen. Nachdem der Landeshauptmann heute in Rom war, ist von der Zuständigkeit die Rede, das neue Gefängnis in Bozen zu bauen — und zwar aufgrund des sogenannten Mailänder Abkommens, das unsere Finanzautonomie neu regelt.
Nun, man könnte die Geschichte auch etwas anders erzählen: Das Land baut eine Justizanstalt nach staatlichen Vorgaben und schenkt sie dem Staat — der seit Jahrzehnten außerstande ist, seinen diesbezüglichen Aufgaben nachzukommen. Das heutige Bozner Gefängnis ist eine Schande und für jeden Häftling eine Zumutung.
Inhaltlich wird das Land Südtirol auch zukünftig kein Mitspracherecht haben, höchstens eines, das sich auf Verhandlungen mit und Zugeständnisse durch den Staat beschränkt. Eine veritable Zuständigkeit ist das nicht.
Obwohl der Staat seine Zuständigkeiten nur mangelhaft wahrnimmt, werden die — angesichts der offensichtlichen Ineffizienz vermutlich überhöhten — Ausgaben stets mit eingerechnet, wenn es darum geht, die von Südtirol empfangenen Gelder aufzurechnen. Dieses Thema wird gesondert zu diskutieren sein.
II.
Im Vergleich zu jenen deutscher Bundesländer wurden die Zuständigkeiten Südtirols schon mehrmals als sehr weitreichend eingestuft. Auch ausgewiesene Fachleute wie Prof. Francesco Palermo von der Eurac bescheinigen dem deutschen Föderalismus eine de facto sehr geringe Dezentralisierung.
Ich selbst bin kein Experte auf diesem Gebiet, sondern beschränke mich vor allem auf Recherchen und Beobachtungen. Wenn ich aber auf dem bayerischen Justizportal lese, was der Freistaat auf diesem Gebiet alles regelt, komme ich nicht umhin daran zu zweifeln, dass die Südtiroler Autonomie diesbezüglich mehr zu bieten hat. Einige Auszüge:
Die Gerichtsbezirke und die Gerichtssitze sind durch das Gesetz über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Freistaat Bayern vom 25. April 1973, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2004, festgelegt.
Zum Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz gehören:
– die Oberlandesgerichte München, Nürnberg und Bamberg
– 22 Landgerichte
– 73 Amtsgerichte
– 11 amtsgerichtliche Zweigstellen
Legt Südtirol seine Gerichtsbezirke und Gerichtssitze eigenständig fest? Gehören die Gerichte in Südtirol zum Geschäftsbereich der Landesregierung?
Der Strafvollzug ist seit dem 1. Januar 2008 durch ein Landesgesetz (Bayerisches Strafvollzugsgesetz) geregelt. Das bislang geltende Strafvollzugsgesetz des Bundes wurde insoweit ersetzt. Dieses Dokument informiert Sie über die Kernaufgaben des Vollzuges.
Art. 2 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes lautet:
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Er soll die Gefangenen befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Behandlungsauftrag).”
Kann das Land Südtirol den Strafvollzug per Landesgesetz autonom regeln? Das wäre dann eine Zuständigkeit.
Natürlich weiß ich nicht, welchen Handlungsspielraum der Freistaat Bayern bei seiner autonomen Gesetzgebung besitzt und wie sehr er sich dagegen an Vorgaben des Bundes halten muss. Darüber wird uns vielleicht ein in diesen Dingen bewanderter Leser aufklären können.