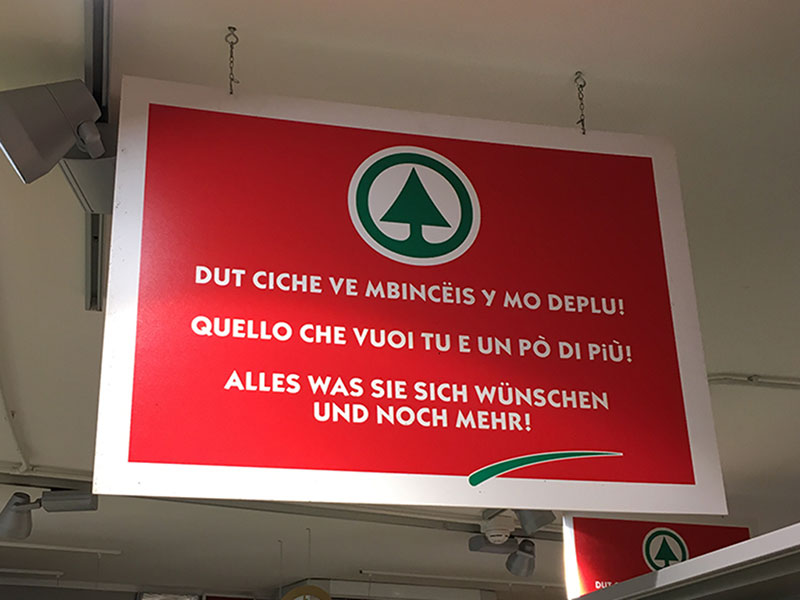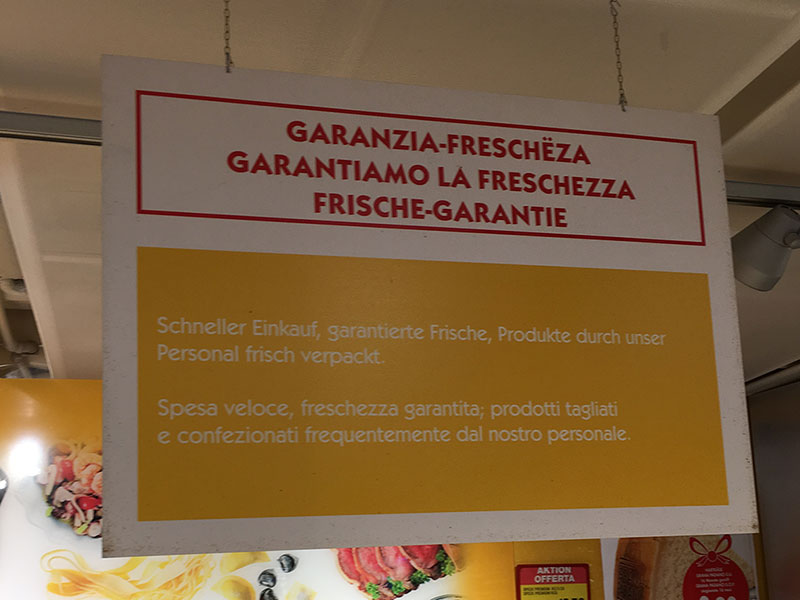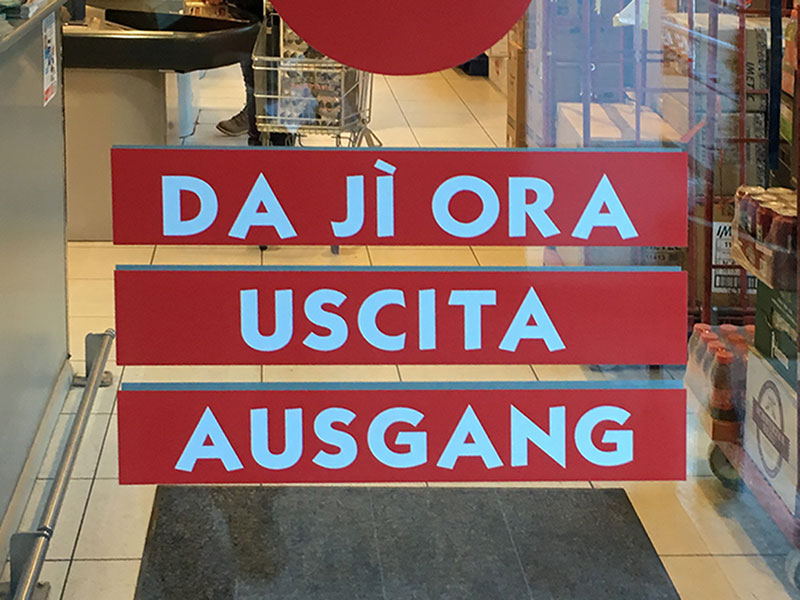Der Flughafen Bozen befindet sich zur Zeit in einem Dornröschenschlaf. Die Startbahn ist wegen Sanierungsarbeiten noch gesperrt, nur einige kleinere Flugzeuge starten und landen auf der Graspiste des “Dolomitenairport”. Nun hat die Landesregierung wieder einmal Großes vor. Es liegt ein Konzept vor, welches versucht, die Entwicklung des Flughafens für die nächsten 20 Jahre aufzuzeichnen. Auf der Webseite des ABD können die Dokumente heruntergeladen werden, sie sind als “streng vertraulich” gekennzeichnet.
Die gute Nachricht ist, dass sich endlich ein spezialisiertes Beratungsunternehmen um die Zukunft des Flughafens Gedanken macht. Der Flughafen soll auf fünf Säulen bauen, welche wie folgt spezifiziert wurden:
-
Feeder und Codeshare (z.B. Rom, Wien)
- Regional Carrier (z.B. Düsseldorf)
- Outgoing Charter (z.B. Ibiza, Mallorca, Sardinien)
- Incoming Charter (z.B. aus England, Skandinavien)
- Business Aviation (Geschäftsreisen)
Es wurden verschiedene Szenarien entworfen, die eine unterschiedliche Entwicklung prognostizieren (Low Case, Base Case, High Case), diese sehen eine Passagierzahl bis 2035 von 230-720.000 vor. Im Jahr 2014 nutzten 65.000 Passagiere den Flughafen. Die Methodik zur Berechnung der Nachfrageentwicklung basiert auf die Schätzung des zukünftigen BIP der jeweiligen Zielländer, sodass daraufhin Flugpläne abgeleitet werden konnten. Die Methodik ist zwar nachvollziehbar, allerdings weiß man in der Regel nicht einmal in 2 Jahren wie das BIP eines Landes sich entwickeln wird. Ein weitere Knackpunkt sind Annahmen, welche Ziele bedient werden sollen, hier war wohl sehr viel Wunschdenken am Werk. Wien soll beispielsweise anfangs 3xwöchentlich bedient werden, später täglich, Rom 2-3 täglich. Angesichts der Tatsache, dass vier Frecce-Hochgeschwindigkeitszüge je Tag und Richtung Bozen mit Rom und anderen Städten verbinden, ein sehr gewagtes Unterfangen. Dass ausgerechnet Wien 1xtäglich angeflogen werden soll, erschließt sich nicht, Innsbruck ist sehr nahe und wird mehrmals täglich mit Wien verbunden. Frankfurt, die vielleicht interessanteste Destination, fehlt, dies dürfte wohl der mangelnden Verfügbarkeit von Slots in Frankfurt geschuldet sein. Der Bereich “Incoming Charter” zeigt eine Reihe von Flügen aus England, Skandinavien und Osteuropa die Südtirol anfliegen sollten, wobei verwunderlich ist, dass ein derartig entwickeltes Urlaubsgebiet wie Südtirol sich nicht bereits früher zu einer (Flug-)Destination entwickelt hat.
Dazu bedarf es wieder erheblicher Investitionen, bis zum Jahr 2035 sollen insgesamt 25 Mio. investriert werden. Die Landebahn muß auf 1.462m ausgebaut werden, damit können Flugzeuge des Typs Boeing 737-700 und Airbus A319 von Bozen aus starten und landen, eine weitere Verlängerung ist nicht sinnvoll, da die seitlichen Sicherheitsabstände für die nächsthöhere Kategorie fehlen, das bedeutet, Ryanair wird nie in Bozen landen und starten können, da diese Airline ausschließlich mit Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 operiert. Somit ist Bozen auf eine eingeschränkte Zahl an Flugbetreibern angewiesen. Die Butter-und-Brot-Flugzeuge A320 und 737-800 fallen nämlich in die nächsthöhere Kategorie. Ein weiterer wichtiger Nachteil des Flughafens ist die Tatsache, dass nur von Süden kommend an- und abgeflogen werden kann, damit können zu Spitzenzeiten (z.B. samstags), wo sich ein Großteil des Charterverkehrs konzentrieren wird, nur 4 Flüge (2 Abflüge, 2 Ankünfte) pro Stunde abgefertigt werden. Damit wird die Kapazität arg beschnitten.
Verwunderlich sind zudem die Annahmen, wie sich die Zahl der Passagiere nach Typ aufteilen werden. Im “Base Case” wird beim “Incoming Charter” von letztendlich 77.000 Passagiere (2035) ausgegangen, dies bedeutet ca. 38.000 Touristen (1xHinflug, 1xRückflug). Wird zusätzlich bei den Linienflügen ein Anteil von 30% an Touristen angenommen (54.000 Touristen), so dürften insgesamt ca. 131.000 Touristen über den Flughafen Bozen unser Land bereisen. Dies entspricht in etwa 2,1% der jährlichen Ankünfte (2014: 6 Mio.) und ist weit von den 5% entfernt, welche die Politik als Entwicklungsziel vorgibt. Damit das Ganze auch erfolgreich wird, sind jährlich 2,5 Mio. Euro an “Airline-Marketing” vorgesehen, d.h. Zahlungen, damit Fluglinien unser Gebiet bedienen. Früher hätte man es Subventionen genannt.
Südtirol ohne Flughafen ist für mich nicht vorstellbar, zusperren sicherlich keine Alternative, zumindest als Infrastruktur sollte der Flughafen erhalten bleiben. Die wirklich hohen Kosten ergeben sich aus den Sicherheitsauflagen, welche bei einem Linien- und Charterverkehr anfallen. Dass nun zum wiederholten Mal öffentliches Geld in die Hand genommen wird, um eine bescheidene Anzahl an Touristen ins Land zu locken, ist der eigentliche Skandal, der sich aber in vielen Regionen Europas immer wieder wiederholt. Zum Beispiel Lübeck, Kassel-Calden, aber auch Friedrichshafen mit mehr als 600.000 Passagieren und einem hohen Defizit. Reinhold Messner hat kürzlich auch für den Flughafen Bozen getrommelt und dabei das Engadin als Beispiel genannt, das mit erstklassigen Touristen aufwarten kann. Was er allerdings nicht erwähnt hat, dass z.B. für die Anreise vom Flughafen Zürich bis Davos oder St. Moritz ca. 3 Stunden (Bahn) aufgewendet werden müssen. Da sind wir in Südtirol längst in Innsbruck, Verona oder München. Kürzlich habe ich in London beinahe meinen Flug versäumt, obwohl ich mich 5 Stunden vor dem Abflug vom Zentrum in Richtung Flughafen aufgemacht habe, so viel zum Thema mangelnde Erreichbarkeit in Südtirol.
Die Landesregierung hat eine beratende Volksbefragung zum Flughafenentscheid beschlossen; angesichts der ständigen medialen Aufrufe, welche viele politischen Vertreter in jüngster Zeit zum Flughafen gemacht haben, lässt sich erahnen, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Politik (SVP), Handelskammer, SMG und nicht zuletzt ein Medienkonzern werden aus vollen Rohren schießen, um die Bevölkerung über die Sinnhaftigeit des Projektes zu “informieren”.


 bereits
bereits