In der Tageszeitung vom 25.10.2014 findet sich ein interessantes Interview mit Daniel Turp, Professor für internationales Recht an der Universität von Montréal. Bemerkenswert auch deshalb, da die Tageszeitung häufig in unqualifizierter Art und Weise über dieses Thema berichtet oder es regelmäßig sogar subtil oder weniger subtil lächerlich macht.
Daniel Turp war von 1997-2000 für den Bloc Québécois Mitglied des kanadischen Parlamentes und für die Parti Québécois von 2003-2008 Mitglied der Assemblée nationale du Québec, also des Regionalparlamentes. Beide Parteien beziehen viele Stimmen vor allem aus der Arbeiterschaft und treiben die Unabhängigkeit Québecs von Kanada voran. Der Bloc Québécois ist derzeit mit den Grünen verbunden.
Im Jahre 2005 initierte Turp ein Projekt zur Ausarbeitung einer Verfassung für Québec.
Einige Aussagen aus dem Interview mit Daniel Turp:
Auf die Frage, ob es einer existentiellen Bedrohung bedürfe, um das Recht auf Selbstbestimmung auszuüben, antwortet Turp:
Nein! Die Unterdrückung ist keine zwingende Voraussetzung, damit ein Volk über seine eigene Zukunft entscheiden kann. Das Selbstbestimmungsrecht hat sich zu einem demokratischen Recht entwickelt. Das heißt: Auch ein Volk, das nicht unterdrückt wird, kann sich auf das internationale Recht berufen, um über seinen politischen Status zu befinden. Es gibt Völker, die nicht mehr unterdrückt werden und dennoch frei sein wollen. Und ich glaube, sie haben alles Recht dazu.
Die Einschätzung Turps widerspricht den Aussagen etlicher SVP-Exponenten diametral. Immerhin Vertreter einer Partei, die häufig darauf verweisen, das Recht auf Selbstbestimmung sei Teil der Parteistatuten. Trotzdem bekräftigt man immer wieder, zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes bedürfe es einer äußeren Bedrohung.
Wirtschaftliche Gründe sind für Turp ein gewichtiges Argument, man sollte sich aber nicht darauf beschränken:
Ein Volk, das sich auf wirtschaftlicher Ebene weiterentwickeln will, möchte die Kompetenzen über die Finanzen übernehmen und die natürlichen Ressourcen eigenständig verwalten können. Das Selbstbestimmungsrecht darf aber nicht auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt werden. Es umfasst auch sprachliche und kulturelle Faktoren; beispielsweise, wenn die Südtiroler um das Fortbestehen ihrer deutschen Sprache fürchten. Darüber hinaus umfasst es soziale und rechtliche Faktoren. Selbstbestimmung — das ist die Freiheit, all das entscheiden zu können, was man will, ohne dass andere diese Freiheit einschränken können.
Letzthin macht sich ein Trend bemerkbar, Südtirols Autonomie in erster Linie mit wirtschaftlichen Interessen gleichzusetzen. Bei aller Bedeutung wirtschaftlicher Entwicklungen für eine Gesellschaft ist diese Reduzierung gefährlich.
Über eine gesellschaftliche Vision, wie sich Südtirol als unabhängiges Land zu einem wirklich mehrsprachigen Land mit einem mehrsprachigen Quellcode entwickeln könnte, also Rahmenbedingungen, die ein Nationalstaat nie bieten kann, verfügt die SVP oder andere Parteien nicht. Nicht umsonst gab es beim Runden Tisch vom 6. Oktober 2014 auf Aussagen, die das  -Modell als eine für Südtirol zukunftsweisende gesellschaftliche Vision präsentierten, vom SVP-Vertreter Karl Zeller und der STF-Vertreterin Eva Klotz nicht die geringste Reaktion.
-Modell als eine für Südtirol zukunftsweisende gesellschaftliche Vision präsentierten, vom SVP-Vertreter Karl Zeller und der STF-Vertreterin Eva Klotz nicht die geringste Reaktion.
Schlimm genug, dass trotz Fokussierung auf wirtschaftliche Belange in Rom, auch was diesen Bereich betrifft, für Südtirol sehr schlechte Ergebnisse verhandelt werden.
Turp unterscheidet zwischen Selbstbestimmung und Sezession und führt an, dass das Ergebnis eines Selbstbestimmungsprozesses auch mehr Autonomie oder ein anderes Ziel sein kann. Gerade in Südtirol werden beide Begrifflichkeiten häufig gleichgesetzt.
Die Frage, ob Südtirol ein Recht auf Selbstbestimmung hat, bejaht Turp.
Ja, das Selbstbestimmungsrecht ist ein demokratisches Recht, das allen Völkern — und damit auch den Südtirolern zusteht.
Leider gibt das Interview keinen ausreichenden Aufschluss darüber was Prof. Turp als Volk versteht. Die Begrifflichkeit Volk, die sich nicht über ethnische Kriterien definiert, sondern als Interessensgemeinschaft, die gemeinsam eine Region bewohnt, kann akzeptiert werden. Und nur dies bildet die sprachliche Vielfalt Südtirols ab. Gerade deshalb betont  in erster Linie das Selbsbestimmungsrecht als Erweiterung von individuellen Bürgerrechten, die als demokratisches Grundprinzip mit dem kollektiven Selbstbestimmungsrecht immer größere Schnittmengen bildet. Warum sollen selbstbestimmte BürgerInnen nicht auch kollektiv über die Interessen ihrer Region abstimmen können?
in erster Linie das Selbsbestimmungsrecht als Erweiterung von individuellen Bürgerrechten, die als demokratisches Grundprinzip mit dem kollektiven Selbstbestimmungsrecht immer größere Schnittmengen bildet. Warum sollen selbstbestimmte BürgerInnen nicht auch kollektiv über die Interessen ihrer Region abstimmen können?
Im weiteren Verlauf des Interviews ergeben sich einige Indizien, dass auch Daniel Turp das Selbstbestimmungsrecht in erster Linie als demokratisches Bürgerrecht versteht.
Turp bricht auch eine Lanze für das Selbstbestimmungsrecht, was die Größe Südtirols betrifft:
Jene, die behaupten, dass Südtirol zu klein dafür sei, liegen falsch. In Europa gibt es viele kleine Staaten, die teilweise noch kleiner als Südtirol sind.
Gibt es Parallelen zwischen Südtirol und Québec?
Es gibt sehr viele Parallelen. Beide Länder unterscheiden sich deutlich vom Nationalstaat, aufgrund ihrer Sprache, ihrer Kultur und ihrer sozialen, politischen und wirtschafltichen Praktiken. Diese Unterschiede verleiten die politischen Bewegungen dazu, größere Unabhängigkeit einzufordern. Im 21. Jahrhundert kann man nicht mehr so argumentieren wie im 19. oder 20. Jh. und sagen: Wir akzeptieren euer Recht auf Selbstestimmung nicht, ihr müsst Teil von Italien bleiben! Die Personen sind wichtiger als das Territorium. Wenn ein Staat behauptet, demokratisch zu sein, muss er das Volk entscheiden lassen. Ein Staat wie Spanien, der das Referendum in Katalonien ablehnt, ist nicht demokratisch.
Ein Plädoyer für die Hierarchie jeder demokratischen Grundordnung. Das Recht muss der Gesellschaft dienen, nicht die Gesellschaft dem Recht. In diesem Sinne ist es per se undemokratisch, wenn bestimmte gesellschaftliche, demokratisch legitimierte Bedürfnisse mit überholten Verfassungsartikeln blockiert werden.
Laut Daniel Turp wird es in Québec nach zwei Referenden im Jahre 1980 und 1995, bei denen sich die Bevölkerung — im Jahre 1995 ganz knapp mit 51% — für einen Verbleib bei Kanada entschieden hat, in naher Zukunft wieder ein Referendum geben. Er ist sich sicher, dass sich Québec dann für die Unabhängigkeit entscheiden wird.
Was bewegt die Menschen dazu, das Risiko einzugehen und unabhängig zu werden?
Freiheit ist immer ein Risiko, aber es ist ein großartiges Risiko. Es ist das bessere Risiko.
Wobei es hier noch anzumerken gilt, dass die Risikobewertung des Status Quo, wie wir in Südtirol gerade erleben, wohl kaum mehr Sicherheit bieten dürfte, als das Szenarium eines unabhängigen Landes. Lieber ein selbstbestimmtes Risiko, als Risiken, die sich dem eigenen Entscheidungsspielraum völlig entziehen.

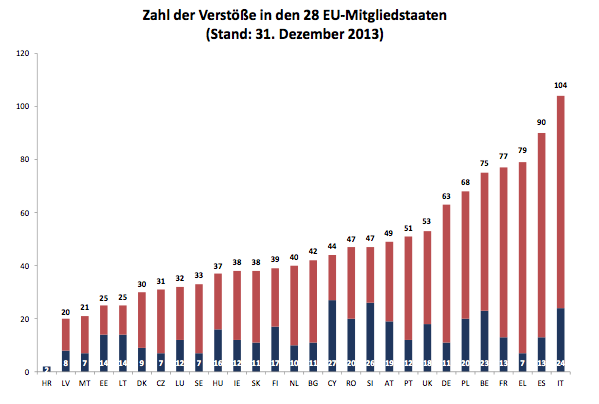
 -Modell als eine für Südtirol zukunftsweisende gesellschaftliche Vision präsentierten, vom SVP-Vertreter Karl Zeller und der STF-Vertreterin Eva Klotz nicht die geringste Reaktion.
-Modell als eine für Südtirol zukunftsweisende gesellschaftliche Vision präsentierten, vom SVP-Vertreter Karl Zeller und der STF-Vertreterin Eva Klotz nicht die geringste Reaktion.
Quotation