[versione in lingua italiana]
Angesichts der im Konvent der 33 kursierenden Vorschläge 01 02 für eine Präambel zum neuen Autonomiestatut, haben sich Christian Mair, Benno Kusstatscher, Simon Constantini und meine Wenigkeit dazu entschlossen, einen Alternativvorschlag zur Diskussion zu stellen, der unserer Meinung nach der Situation und dem Selbstverständnis Südtirols im 21. Jahrhundert besser entspricht.
Sehr geehrte Mitglieder des Konvents der 33,
was könnte unser kollektives Selbstverständnis als Südtirolerinnen und Südtiroler anderes sein, als ein bedingungsloses Bekenntnis zur Zukunft? Nicht die Betonung der Bedeutung politischer Verträge, nicht politische Sachzwänge, die durch professionell-juridische Fachsprache neutralisiert werden müssen, und schon gar nicht eine übertrieben komplette Auflistung von Schlagwörtern unserer üblichen Tagesdebatten, die letztlich nur den Baustellencharakter des Landes betonen; nichts davon sollte in der Präambel unseres neuen Autonomiestatus festgeschrieben werden, sondern vielmehr – so sind wir uns in ungewohnter Allianz absolut einig – das destillierte Wesentliche der angestrebten Zukunft, das erst nach radikal-konsequentem Verzicht auf liebgewordenen aber letztlich doch altbackenen Ballast, auf historisches Selbstmitleid und auf überstrapazierte Allgemeinplätze in der Reduktion zu erfassen ist:
Alternativentwurf für die Präambel des neuen Südtiroler Autonomiestatuts
Wir, alle Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes,
- sind uns der bewegten Geschichte bewusst, die dieses Bergland im Dialog mit den bedeutenden Kulturen aus Nord und Süd bereichert, geprägt und gegliedert hat;
- verstehen die sprachliche und kulturelle Vielfalt und Eigenständigkeit unseres Landes als Reichtum, als Chance und als Auftrag, Brückenbauer statt Grenzland zu sein;
- sind bestrebt, unseren stetigen Beitrag zur friedlichen Ausgestaltung unserer europäischen Familie zu leisten, hin zu einem lebenswerten, nachhaltigen und gerechten Ort der Begegnung, geeint in Freiheit und selbstbestimmter Vielfalt;
- sind uns unserer besonderen Verantwortung für den Erhalt des ökologischen und kulturellen Erbes des Alpenbogens bewusst, dem wir uns in Solidarität mit den anderen Alpenbewohnerinnen und Alpenbewohnern und in Freundschaft mit den umliegenden Ebenen und Metropolen verpflichtet fühlen;
- bekennen uns zum humanistisch aufgeklärten Wertesystem, um in Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger unsere Rechte und Pflichten individuell wahrzunehmen und gemeinsam als Souverän die Geschicke unseres Landes zu bestimmen;
- begreifen Toleranz, Inklusion, gegenseitigen Respekt und Chancengleichheit im Inneren als Grundsäulen für das friedliche Erblühen nachkommender Generationen auf einem zusammenwachsenden Planeten;
- sehen uns, auch aufgrund unserer Geschichte, der Kraft der Subsidiarität verschrieben und der Verteidigung von Minderheitenrechten auf allen Ebenen – innerhalb, aber auch außerhalb unseres Landes – verpflichtet;
- bauen diese unsere Zukunft im Schoß der europäischen Gemeinschaft in Dankbarkeit gegenüber den großen Frauen und Männern der österreichischen, italienischen und internationalen Politik für das Geleit aus vergangenen Krisen;
- wünschen uns, den Weg gemeinsam mit unseren beständigen Begleitern, den Menschen in Nordtirol, Osttirol, Trentino und Souramont – ohne äußere Abgrenzung und weitere Nachbarn einladend – zu beschreiten;
- möchten dabei unsere Verbundenheit auch mit allen anderen umliegenden Ländern, Regionen und Kantonen zum Ausdruck bringen, sowie die Selbstverständlichkeit, partnerschaftlicher Teil der gleichen Solidargemeinschaft sein zu wollen.
27. Mai 2017
Christian Mair, Benno Kusstatscher, Harald Knoflach, Simon Constantini

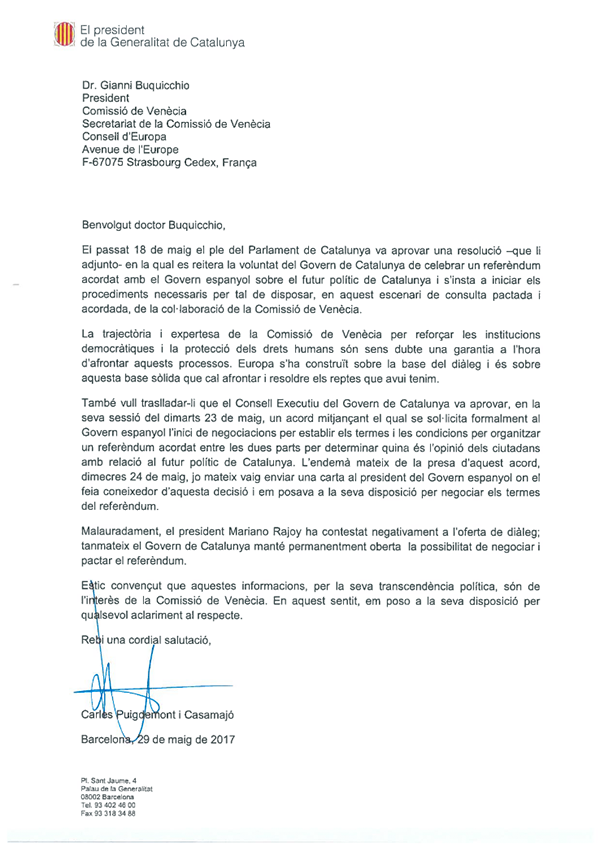


Quotation