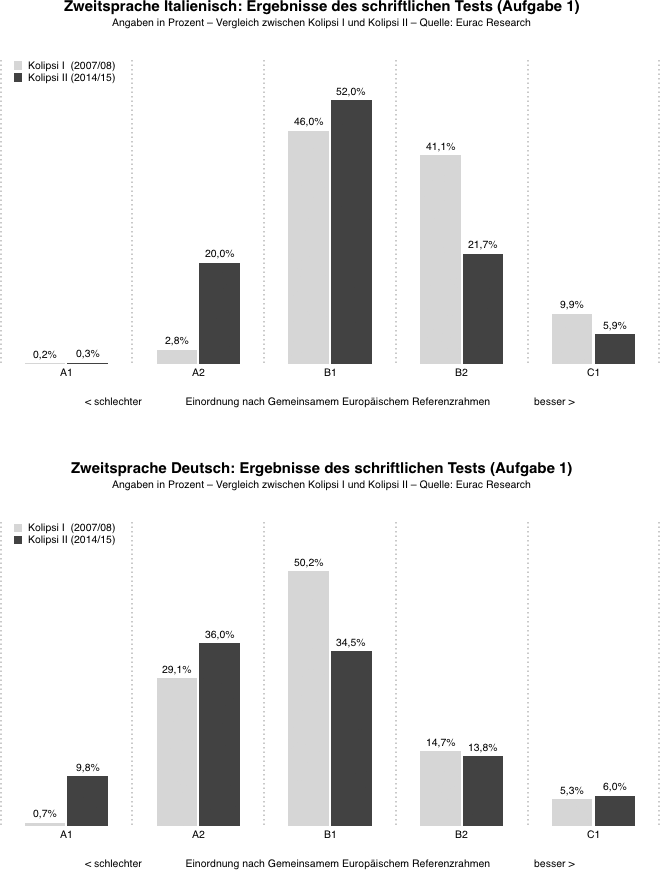In der Sitzung des K33 vom 19.5.17 wurden die Vorschläge Christoph Perathoners (SVP) zu Ladinien und zur Präambel für das neue Autonomiestatut behandelt.
Der Katalog, den Perathoner präsentierte, war sehr umfangreich und zielte darauf ab, die Rechte der Ladiner zu stärken und Anomalien zu beseitigen. Die Ladiner sind für ihn eine “Minderheit in der Minderheit”, die es besonders zu schützen gilt. Aus diesem Grund sollten alle bestehenden Diskriminierungen beseitigt werden. Als Beispiele nannte er, dass ein Ladiner im restlichen Staatsgebiet Verwaltungsricher werden kann, nur nicht in Südtirol; in der 6er-Kommission keine Ladinervertretung vorgesehen ist und dass ein Ladiner nicht Landeshauptmann-Stellvertreter werden kann.
Weitere Forderungen zielten darauf ab, die Bezeichnung des Landes Südtirol stets dreisprachig zu publizieren, eine ladinische Einheitssprache festzuschreiben, ladinischen SchülerInnen die Möglichkeit zu gewähren, auch außerhalb des ladinische Siedlungsgebietes eine Schule zu besuchen, wo die ladinische Sprache erlernt werden kann. Ladinische Exonyme sollten überall sichtbar gemacht werden, wie beispielsweise Bulsan, Tluses, Bornech. Umstritten war die Forderung, dass den Ladinern zumindest zwei Landtagsmandate garantiert werden sollen — Luis Durnwalder (SVP) bemerkte zu Recht an, dass damit die Ladiner strategische wählen könnten, da sie einem Nicht-Ladiner ihre Stimme geben könnten, mit der Sicherheit, dass ladinische Kandidaten sowieso in den Landtag gewählt würden. Diesen Punkt griffen natürlich sofort die italienischen Landtagsvertreter auf, die damit die Chance sahen, auch den Italienern eine Mindestzahl an Vertretern zu garantieren. Ich finde dies demokratiepolitisch äußerst fragwürdig, weil der Wählerwille unter Umständen nicht respektiert wäre. Ebenso umstritten war der Vorschlag, dass die Proporzregelung, wie von Perathoner und Edith Ploner (SVP) gefordert, zu Gunsten der Ladiner aufgeweicht werden sollte. Auch hier sahen die italienischsprachigen Vertreter und Riccardo Dello Sbarba (Grüne) die Chance, den Proporz im Ganzen in Frage zu stellen. Eine Dreisprachigkeitszulage für all jene öffentlichen Bediensteten, die die ladinische Sprache beherrschen, könnte als Förderung der Sprache auch für Nichtladiner angesehen werden. Ich finde den Vorschlag interessant, allerdings müsste die Finanzierbarkeit geprüft werden. Ein weiteres interessantes Detail förderte Perathoner zu Tage: So können LadinerInnen bei Gericht in ihrer Muttersprache verhört werden, das Protokoll wird aber in der Prozesssprache (Deutsch oder Italienisch) abgefasst, hingegen kann beispielsweise ein Türke in einem Prozess fordern, dass das Protokoll auf Türkisch verfasst wird. Das Anliegen der Ladiner von Col, Anpezo und Fodom wurde auch diskutiert, hier betonte Durnwalder, dass wir nicht von den anderen Regionen fordern können, dass diese Gemeinden abgetreten werden, allerdings sollte ein klares Signal an diese LadinerInnen gerichtet werden, dass wir sie mit offenen Armen empfangen würden. Die ladinischen Anliegen wurden insgesamt sehr positiv aufgenommen, die zum Teil berechtigten Einwände sollen in einen überarbeiteten Vorschlag eingearbeitet werden. Perathoner und Ploner werden diese Aufgabe übernehmen.
Der zweite Teil der Sitzung sollte sich mit der Präambel für das neue Autonomiestatut beschäftigen, wobei hier allerdings die Zeit fehlte, eingehender darauf einzugehen. Bei der nächsten Sitzung sollte der Diskurs vertieft werden. Es wurden zwei Vorschläge eingereicht, einen davon habe auch ich im Vorfeld unterstützt — er wurde von Florian von Ach an das Präsidium übermittelt.
Das Land Südtirol bekennt sich
- zur Freiheit und Würde des Menschen;
- zu den jüdisch-christlichen Traditionen des Landes im Geiste von Aufklärung, Humanismus und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung;
- zum mehrsprachigen Charakter Südtirols mit seinen drei autochthonen historischen Landesprachen und zum friedlichen Zusammenleben;
- zum besonderen Minderheitenschutz für die deutsche und die ladinische Volksgruppe;
- zum Pariser Vertrag, wobei dieses Autonomiestatut einen wesentlichen Durchführungsakt des Pariser Vertrages darstellt;
- zur Rolle Österreichs als Vaterland und Inhaber der völkerrechtlichen Schutzmachtfunktion für die deutsche und die ladinische Volksgruppe;
- zu einem freien und vereinten Europa der Regionen, wobei das Eintreten für die Einheit der Tiroler Landesteile ein wesentlicher Ausdruck dieses Bekenntnisses ist;
- zum Völkerrecht und zum demokratischen Selbstbestimmungsrecht, um über Südtirols politischen Status frei zu entscheiden und frei die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu bestimmen.
Dieser Vorschlag spiegelt für mich sehr gut den Charakter und die möglichen gesellschaftlichen Ziele unseres Landes wider, einzig auf die Formulierung “zur Rolle Österreichs als Vaterland” hätte ich lieber verzichtet.
Der zweite Text wurde, nachdem Florian von Ach signalisiert hatte, auch diesen zu unterstützen, eingehender diskutiert. Das Dokument ist juridisch wesentlich ausgefinkelter formuliert und wurde von allen Seiten grundsätzlich positiv aufgenommen, auch wenn Roberto Bizzo (PD) und Dello Sbarba und wahrscheinlich auch alle übrigen italienischsprachigen VertreterInnnen mit Ausnahme von Walter Eccli, den Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht ablehnen. Entgegen anderslautenden Medienberichten kam es im Konvent nicht zu hitzigen Diskussionen, dazu gab es kaum Zeit. Dello Sbarba lehnte auch den Vorschlag ab, einen Verweis auf die “christlich-abendländischen Wurzeln” in das Dokument aufzunehmen. Rechtsexpertin Esther Happacher meinte, dass dieser Entwurf einem Verfassungstext gleiche und fragte in die Runde, ob unser Konvent einen Alleingang ohne Trient beabsichtige.
Die Präambel hat gefühlt eine enorme Wichtigkeit für den Konvent. Bei der nächsten Sitzung wird weiter diskutiert, vermutlich wird sich alles um die Gretchenfrage drehen, ob das Selbstbestimmungsrecht verankert wird oder nicht.
Serie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV