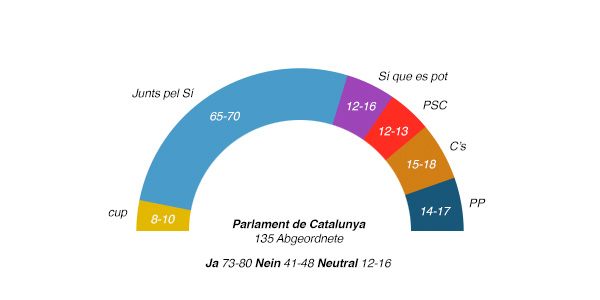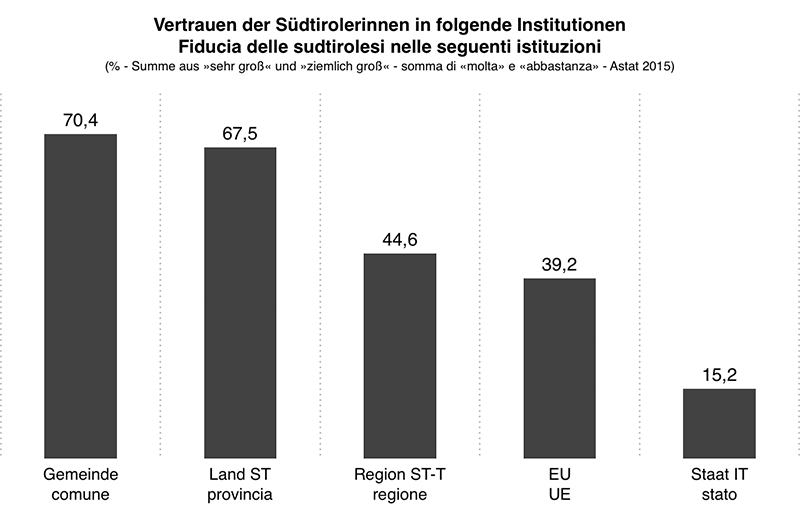Während der gestrigen Diskussion mit Hans-Adam II. von Liechtenstein und Wolfgang Niederhofer ( ) hat der Landeshauptmann in der Schlussrunde, nach der also keine Stellungnahmen oder Fragen aus dem Publikum mehr gestattet waren, die immer wieder vorgebrachte Behauptung wiederholt, Schottland hätte über seine Unabhängigkeit abstimmen dürfen, weil das Vereinigte Königreich keine Verfassung habe und dort somit auch kein verfassungsrechtliches Einheitsgebot existiere. Cameron habe daher die Möglichkeit gehabt, den Schotten eine Abstimmung zu gewähren.
) hat der Landeshauptmann in der Schlussrunde, nach der also keine Stellungnahmen oder Fragen aus dem Publikum mehr gestattet waren, die immer wieder vorgebrachte Behauptung wiederholt, Schottland hätte über seine Unabhängigkeit abstimmen dürfen, weil das Vereinigte Königreich keine Verfassung habe und dort somit auch kein verfassungsrechtliches Einheitsgebot existiere. Cameron habe daher die Möglichkeit gehabt, den Schotten eine Abstimmung zu gewähren.
Lassen wir einmal unbeachtet — aber nicht unerwähnt — dass der heutige SVP-Chef Philipp Achammer noch 2012 behauptet hatte, Westminster werde die Schotten sicher »niemals« abstimmen lassen. Zwei Jahre später war die Selbstbestimmung vollzogen, so viel zum Thema »Realismus«.
Dass das Vereinigte Königreich keine oder wenigstens keine geschriebene Verfassung habe, ist ein häufiges Missverständnis. Das Portal verfassungen.eu zitiert aus Günther Doekers und Malcolm Wirths »Das politische System Großbritanniens«:
In der wissenschaftlichen Literatur zum britischen Regierungssystem wird vielfach festgestellt, dass es eine geschriebene britische Verfassung nicht gebe. Wenn man davon ausgeht, dass eine Verfassung ein zusammenhängendes und kompaktes Dokument im Sinne kontinentaleuropäischer Verfassungstheorie und -praxis ist – wie etwa das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika – dann ist diese Feststellung zutreffend. Geht man hingegen davon aus, dass eine Verfassung ein System fundamentaler Prinzipien und Regeln darstellt, aufgrund dessen politisch-autoritative Entscheidungen und Werturteile getroffen werden, so kann man sehr wohl von einer britischen Verfassung sprechen, welche darüber hinaus in Gesetzen .und anderen verfassungsrechtlichen Dokumenten festgeschrieben wurde. Insoweit existiert auch eine geschriebene britische Verfassung, selbst wenn ein zusammenhängendes und alles erfassendes Dokument nicht vorhanden ist.
Zu diesen verfassungsrechtlichen Dokumenten zählt laut Günther Doekers und Malcom Wirth auch der »Union with Scotland Act«:
Die für den britischen politischen Entscheidungsprozeß entscheidenden verfassungsrechtlichen und verfassungspolitischen Voraussetzungen sind grundsätzlich in Gesetzen konkretisiert und festgeschrieben worden. Die Staatsgrenzen und die Staatsorganisation Großbritanniens sind im Union with Scotland Act, 1706 festgehalten […]
Wir halten fest: Es gibt zwar keine zusammenhängende britische Verfassung, dafür aber sehr wohl Dokumente, die im Verfassungsrang stehen, wozu auch das Gesetz zählt, welches die Einheit mit Schottland besiegelt. Dies allein würde es Westminster — wenn es nicht demokratisch, sondern ausschließlich aufgrund geltenden Rechts argumentieren würde — ermöglichen, eine Diskussion über die Loslösung Schottlands zu verhindern, und das zumindest so lange, bis die Auflösung des sogenannten Union Act eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament hat.
Wollte man den Union Act mittels Volksabstimmung außer Kraft setzen, müssten alle BürgerInnen des Vereinigten Königreichs abstimmen.
Doch es kommt noch dicker. Artikel 1 des Union Act besagt nämlich:
That the two kingdoms of England and Scotland shall upon the first day of May which shall be in the year one thousand seven hundred and seven and for ever after be united into one kingdom by the name of Great Britain and that the ensigns armonial of the said United Kingdom be such as her Majesty shall appoint and the crosses of St. George and St. Andrew be conjoyned in such manner as Her Majesty shall think fit and used in all flags, banners, standards and ensigns both at sea and land.
(Hervorhebung von mir.)
»For ever after«, das heißt soviel wie »für immer und ewig« oder »für alle Zeiten«! Das ist sogar mehr, als in der italienischen Verfassung steht, denn es handelt sich streng genommen um eine in Verfassungsrang stehende Ewigkeitsklausel. Aber: Manche Länder lehnen die »Judizialisierung der Politik« ab, wonach der politische Wille in juristische Geiselhaft genommen wird, und setzen ganz unaufgeregt auf die Demokratie. Das unterscheidet das Vereinigte Königreich von Ländern wie Spanien und Italien: Die Demokratie und nicht die angebliche Abwesenheit einer geschriebenen Verfassung.
Demokratie aber sollten wir als Demokraten alle einfordern, ganz egal ob wir in Schottland, in Katalonien oder in Südtirol daheim sind, auch der Landeshauptmann.
Camerons Regierung hatte im Vorfeld der Einigung zur schottischen Abstimmung übrigens ganz klar gesagt:
Ich nehme an, wir könnten die verfassungsrechtliche Frage aufwerfen, wer die Zuständigkeit hat [eine Volksabstimmung einzuberufen] und wer nicht, doch ich glaube, das wäre kein sinnvoller Zeitvertreib. Wenn das aktuelle Thema die Zukunft Schottlands innerhalb des Vereinigten Königsreichs ist, dann ist es wichtiger, diese Debatte zu führen, als darüber zu diskutieren, ob wir die Debatte führen dürfen.
— Michael Moore, damaliger Staatssekretär für Schottland der britischen Regierung