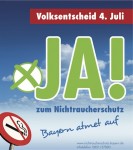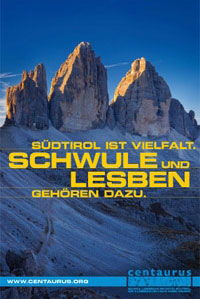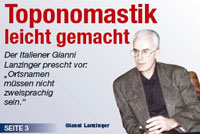Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat heute den Inhalt seines Rechtsgutachtens über die einseitige Unabhängigkeitserklärung des kosovarischen Parlaments Anfang 2008 bekanntgegeben. Das höchste Rechtssprechungsorgan der UNO befindet darin, dass Kosovo nicht gegen internationales Recht verstoßen habe, weil dieses unilaterale Unabhängigkeitserklärungen nicht verbiete. Der Präsident des Tribunals, Hisashi Owada, wies ausdrücklich darauf hin, dass das Urteil nicht bindend sei. Außerdem unterstrich er die Besonderheit des untersuchten Falles. Bis heute wurde Kosovo von 69 der 192 UNO-Mitgliedsländer (und 22 von 27 EU-Mitgliedern) anerkannt. Das Gericht gab heute seine Entscheidung bekannt, nachdem Ende 2009 die Argumente von über 30 befürwortenden und ablehnenden Ländern angehört worden waren. Nachdem Serbien vor dem IGH geklagt hatte, legitimiert dieses Urteil nun das Vorgehen Kosovos.
Der Internationale Gerichtshof ging auch auf die Resolution Nr. 1233 des UNO-Sicherheitsrates ein, die im Juni 1999 verabschiedet wurde und welche eine vorläufige Rechtsordnung festlegte, die dazu dienen sollte, die Stabilität in der Region herzustellen. Ein Teil dieser Resolution beauftragte die UNO damit, einen politischen Prozess anzustoßen, um den Status des Kosovo zu definieren. Das Gericht kam diesbezüglich zum Schluss, dass auch diese Resolution die Unabhängigkeit nicht berührt, da sie eine einseitige Unabhängigkeitserklärung nicht verbiete. Sie sei ausschließlich dazu gedacht gewesen, eine Verwaltungsgliederung innerhalb Kosovos zu schaffen. Deshalb stehe Resolution Nr. 1244 nicht im Widerspruch zur einseitigen Unabhängigkeitserklärung.
Außerdem kommt das Tribunal zum Schluss, dass im Falle einseitiger Unabhängigkeitserklärungen gemäß internationalen Rechts die “verfassungsmäßige” Legalität im von der Sezession betroffenen Staat weder bindend noch in irgend einer Form relevant sei. Diesbezüglich erinnerte Herr Owada daran, dass mehr als die Hälfte der heutigen 192 UNO-Mitgliedsländer vor einem halben Jahrhundert nicht existierten, und dass die Mehrheit der betreffenden Unabhängigkeitsprozesse nach dem Recht der von Sezession betroffenen Staaten nicht legal gewesen wären, weil zum Beispiel die innere Verfassungsordnung dagegen sprach.
Der heutige Entscheid des IGH könnte Neuheiten in diesen Rechtsbereich bringen, für den es kaum internationale Gesetzgebung oder Rechtsprechung gibt. Die Legitimierung der einseitigen Sezession des Kosovo könnte sich auf andere Unabhängigkeitsprozesse auswirken, nachdem dadurch eines der wichtigsten Gegenargumente der Staaten entfällt: Die Unantastbarkeit der Grenzen (territoriale Integrität).
Obwohl das Urteil im Falle Kosovos keine unmittelbaren Folgen hat — weil es niemanden dazu verpflichtet, Kosovo anzuerkennen — wird doch damit gerechnet, dass sich jetzt weitere Staaten dazu entschließen werden, diplomatische Beziehungen zum Balkanland aufzunehmen.
Kosovo hat seine Unabhängigkeit von Serbien am 17. Februar 2008 mit einer unilateralen Erklärung seines Parlaments verkündet. Vier Monate später beschloss Kosovo das Inkrafttreten seiner Verfassung. Damit übernahm die Regierung des Landes zahlreiche Zuständigkeiten eines souveränen Staates.
Neunundsechzig Länder (22 von 27 EU-Mitgliedern) anerkennen Kosovo offiziell, darunter die USA, Frankreich, Italien, Deutschland, Vereinigtes Königsreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Irland, Schweden, Island, Slowenien, Kroatien, Costa Rica, Österreich, Senegal, Estland, Dänemark, Lettland, Perù, Finnland, Japan, Kanada, Ungarn, Norwegen, Litauen, Kolumbien, Portugal, Montenegro, Australien, Tschechien und Bulgarien.
Von den 27 EU-Mitgliedsstaaten verweigern bis dato nur Griechenland, Zypern, Rumänien, Spanien und Slowakei eine Anerkennung.
Quelle: Racó Català
Übersetzung: