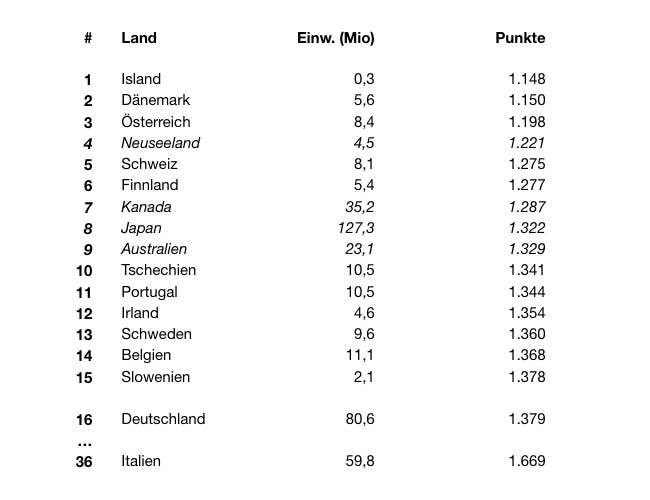Der Schweizer Historiker Aram Mattioli hatte in einem Buch vor der »Aufwertung des Faschismus« in Italien gewarnt. Doch fördert der italienische Staat gar den großserbischen, ethnisch-nationalistischen Expansionismus? Womöglich im Zusammenspiel mit faschistischen und ultranationalistischen Gruppierungen aus Italien und Serbien?
»Accendiamo la Speranza« (Entfachen wir die Hoffnung) ist die Bezeichnung eines Kooperationsprojekts zur Unterstützung der serbischen — und nur der christlich-serbischen — Bevölkerung im Kosovo, das zwischen 2009 und 2010 entstand und bis 2012 andauerte. Es wurde von der Volontariatsorganisation LOVE mit Sitz in Riva del Garda koordiniert.
Die Kooperation stützte sich, wie aus einer Broschüre von 2012 hervorgeht, auf (Sach-)Spenden und bestand aus sogenannten »Solidaritätsbesuchen« vor Ort sowie »Informationsveranstaltungen« in Italien, bei denen die Zugehörigkeit von Kosovo und Mitrohina (die offizielle serbische Bezeichnung für den Kosovo) zu Serbien unterstrichen wurde. Das gesamte Projekt folgte der »identitären Idee« der neuen Rechten (Ethnopluralismus), wonach die Welt zwar kulturell vielfältig, diese Vielfalt jedoch in den jeweiligen Heimatregionen bleiben und dort nicht vermischt werden soll. Selbstverständlich gibt es auch in dieser Vorstellung — zumindest latent — Hierarchien zwischen besseren/überlegenen (und somit föderdungswürdigen) bzw. schlechteren/minderwertigen Völkern und Ethnien. Im Facebook-Profil von LOVE etwa äußert sich dies durch eine außergewöhnliche Konzentration negativer und alarmistischer Nachrichten über den kosovarischen Staat oder die angebliche Gewaltbereitschaft der dortigen Muslime (über den Kosovo hinaus) und positiv konnotierte Nachrichten über Serbien und die christlich-serbische Gemeinschaft des Kosovo. Dieses strikte Gruppendenken allein sollte in Bezug auf eine Volontariatsorganisation schon Zweifel aufkommen lassen.
In einer Selbstvorstellung kritisiert LOVE den Individualismus und stellt diesem die Gemeinschaft, das Volk gegenüber. Die ideologischen Bezugspunkte reichen vom protofaschistischen Philosophen D’Annunzio bis zu Ezra Pound.
»Accendiamo la speranza« wurde laut Projektbeschreibung von einer unappetitlichen Mischung neofaschistischer Vereine sowie öffentlicher und halböffentlicher Institutionen vorangetrieben und unterstützt. In alphabetischer Reihenfolge erstgenannt sind unter den Beteiligten die italienische Botschaft in Prishtina und die Serbische Botschaft in Rom. Doch auch das Italienische Rote Kreuz und die Autonome Provinz Trient befinden sich darunter.
Die genaue Rolle der italienischen Botschaft ließ sich nicht ermitteln: Eine entsprechende Anfrage ist seit zwei Wochen unbeantwortet geblieben. Dagegen ergibt eine Internetrecherche, dass die Trentiner Entwicklungshilfe mindestens 10.580,25 Euro in die Initiative gesteckt hat, und zwar über die Associazione L’Uomo Libero mit Sitz in Arco. Insgesamt hat dieser Verein für seine Projekte seit dem Jahr 2000 rund 50.000 Euro aus den Fonds von Trentino Cooperazione erhalten.
L’Uomo Libero setzt sich wie LOVE nicht so sehr für Menschen, sondern vor allem für Völker ein — und hatte etwa bei der Unterstützung des karischen Volkes mit CasaPound gemeinsame Sache gemacht. Auch in Bozen. L’Uomo Libero erinnert auf seiner Webseite an den angeblichen »Holocaust« der Italiener auf der Krim, nimmt an Veranstaltungen der Alpini teil und gedenkt zusammen mit dem nicht ganz lupenreinen Kriegsbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge regelmäßig »aller Toten aller Kriege«, eine Lieblingsfloskel italienischer Rechter.
Doch die Reihe der Unterstützerinnen von »Accendiamo la Speranza« ist lang und umfasst unter anderem:
- Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, eine Vereinigung der Gewerkschaft CISL.
- ENEL, staatlicher Energieversorger.
- Hell’s Angels, der Motorrad- und Rockerclub, der immer wieder durch seine Verstrickungen in kriminelle Tätigkeiten und Vorfälle in die Schlagzeilen gerät.
- »Kulturvereinigung« La Perla Nera aus Novara, hinter der sich nichts anderes als die örtliche CasaPound-Sektion verbirgt.
- Lealtà e Azione aus Monza, eine Neonazi-Gruppierung.
- Mazzardita, der CasaPound-Ableger in Verbania.
- Solidarité-Identités, Volontariatsorganisation der identitären Bewegung mit Kontakten zu CasaPound.
- Ultima Frontiera, rechtsextremistische Band aus Triest.
- »Kulturvereinigung« Zenit aus Rom, die auf ihrer martialisch anmutenden Webseite unter anderem den griechischen Neonazis der Goldenen Morgenröte ihre Solidarität ausspricht, weil diese Opfer »demokratischer Attentate« geworden seien.
Außerdem wurde über »Accendiamo la Speranza« ausgiebig auf dem faschistischen Online-Radiosender RadioBandieraNera berichtet, unter anderem weil auch der (ehemalige) CPI-Präsident Gianluca Iannone Teil einer Spenderdelegation im Kosovo war.
Die Zusammenarbeit institutioneller Kooperationspartnerinnen mit neofaschistischen Vereinen und Organisationen, die über ihre Projekte ihr rassistisches Menschenbild transportieren und gleichzeitig ihr Image aufpolieren können, ist beunruhigend. Gerade öffentliche Akteurinnen hätten die Aufgabe, äußerst penibel zu überprüfen, in wessen Gesellschaft sie sich begeben, da sie erstens Steuergelder verwalten und zweitens ihre Teilnahme an Projekten vielen Bürger- und potentiellen Spenderinnen als Glaubwürdigkeitsnachweis gilt.
Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 || 01