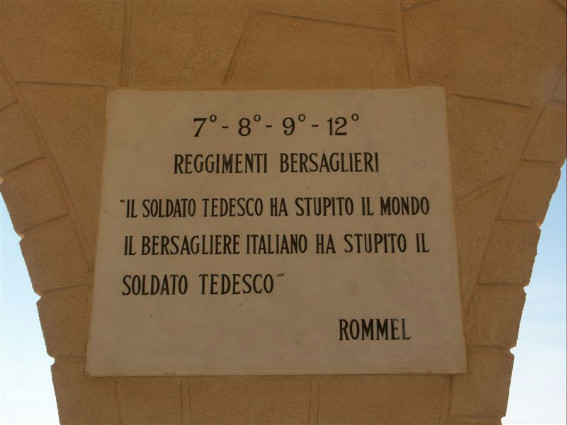Am gestrigen Freitag traf der Konvent der 33 zum ersten Mal in Arbeitsgruppen zusammen. Nach langen und mühseligen Diskussionen konnten wir erstmalig konkret an unserem “strukturierten Dokument”, welches zum Abschluss der Arbeiten an den Landtag übergeben wird, arbeiten. Als Laura Polonioli einen Versuch unternahm, den Beginn wieder zu verzögern, indem sie einen Vorschlag über die Arbeitsweise einbrachte, riss mir beinahe der Geduldsfaden; in fast jeder Sitzung wurde über die Arbeitsweise diskutiert, bei der letzten Sitzung wurde dann beschlossen, dass wir in drei Arbeitsgruppen an unseren Vorschlägen zur Reform des Autonomiestatutes arbeiten wollen. Ich konnte es kaum erwarten, endlich konkret daran zu arbeiten und war überzeugt, dass wir nun einen qualitativen Sprung machen würden. Für mich gingen zwar die bisherigen Arbeiten im Plenum in Ordnung, allerdings kam es nie zu echten Diskursen, vielmehr wurden von meist denselben Personen Statements vorgebracht.
Die Arbeitsgruppen haben eine Größe von elf Personen, die vom Präsidium eingeteilt wurden. In jeder Gruppe gibt es je einen Rechtsexperten (Happacher, von Guggenberg, Toniatti) und ein ausgewogenes Verhältnis der übrigen Teilnehmer nach objektiven Kriterien. Ich bin in einer Arbeitsgruppe zusammen mit Roberto Toniatti, Luis Durnwalder, Laura Senesi, Maurizio Vezzali (gestern abwesend), Edith Ploner, Olfa Sassi, Magdalena Amhof, Beatrix Mayrhofer, Ewald Rottensteiner und schließlich Andreas Widmann (der den Vorsitz führt) eingeteilt. Die Gespräche waren sehr anregend, es gab die Möglichkeit zu Diskursen, zudem erweist sich Roberto Toniatti als eine echte Bereicherung. Thema der Gespräche waren die zukünftigen Kompetenzen. Wir protokollierten bereits einige interessante Forderungen wie beispielsweise, dass sämtliche sekundäre und tertiäre Kompetenzen in primäre umgewandelt werden sollen. Hier herrschte Konsens, auch hinsichtlich der Abschaffung der Suprematieklausel und den AKBs. Beim “nationalen Interesse” gab es keinen Konsens, deshalb werden hier zwei Standpunkte nebeneinander gleichberechtigt stehen bleiben.
Zusammengefasst kann man sicherlich von einer interessanten und sehr kontstruktiven Sitzung sprechen, von den beiden anderen Gruppen habe ich ähnliches vernommen.
Serie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV