Im Rahmen und im Vorfeld des Südtirolkonvents ist erneut die Debatte um die mehrsprachige Schule entbrannt — und das ist gut. Alle Themen, die den Südtirolerinnen am Herzen liegen, sollen jetzt aufs Tapet.
Auf  wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, weshalb wir im Rahmen eines Nationalstaats nicht oder nur unter ganz bestimmten Umständen für eine mehrsprachige Schule wären. Ich möchte die aktuelle Gelegenheit aber noch einmal wahrnehmen, um es mit einem Vergleich zu versuchen.
wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, weshalb wir im Rahmen eines Nationalstaats nicht oder nur unter ganz bestimmten Umständen für eine mehrsprachige Schule wären. Ich möchte die aktuelle Gelegenheit aber noch einmal wahrnehmen, um es mit einem Vergleich zu versuchen.
Meiner Ansicht nach fehlt es der paritätischen Gemeinschaftsschule, wie sie von einigen in Südtirol gefordert wird, schlichtweg an Nachhaltigkeit. Wir alle wissen, dass die immersive mehrsprachige Schule »funktioniert«, wenn man die kurzfristigen Erfolge an den Sprachfertigkeiten der Schülerinnen misst.
Man könnte es Egoismus nennen, doch es ist absolut legitim, wenn Eltern von Schülerinnen diesen »beschränkten« Maßstab anlegen; ihnen geht es vordergründig um das kurzfristige Wohlergehen ihrer Sprösslinge.
Aber wir wissen ja beispielsweise auch, dass Atomkraftwerke aus ökologischer Sicht »funktionieren«, wenn wir unmittelbar ihren CO2-Ausstoß erheben. Man verzeihe mir den unorthodoxen, dafür aber umso »bildlicheren« Vergleich: Würden wir uns nur um das Hier und Jetzt sorgen, wären Atomkraftwerke ein sehr effektiver Beitrag zur Erreichung wichtiger Umweltschutzziele. Energiekonzerne argumentieren mitunter so und lassen dabei mutwillig außer Acht, dass die Entsorgung von Atommüll ein wahrscheinlich unlösbares Problem darstellt.
Glücklicherweise gab es letzthin zumindest in einigen Ländern ein Umdenken: Wir sollten nämlich nicht nur darauf schauen, was uns kurzfristig nützt, sondern müssen auch berücksichtigen, was die Folgen unseres Handelns sind. Bezüglich unmittelbarer Risiken, aber vor allem auch in Hinblick auf künftige Generationen.
Und genauso wenig, wie heute jemand sagen würde, dass Atomkraftwerke nachhaltig sind, würde ich dieses Attribut auf die paritätische Schule in Südtirol anwenden — wenigstens in Anbetracht der Tatsache, dass wir ein kleines, mehrsprachiges Land in einem großen, weitgehend einsprachigen Nationalstaat sind. Wenn wir den assimilatorischen Druck des Zentralstaats unberücksichtigt lassen, wird die perfekte Zweisprachigkeit der Individuen wohl über kurz oder lang auf Kosten der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit gehen.
Sprich: Wenn alle der Sprache des — weitgehend einsprachigen — Staates gleichermaßen mächtig sind, hätten wir möglicherweise keinen Anspruch auf Gebrauch der Muttersprache mehr. Wollen wir das?
Schon heute gibt es in diesem Bereich eklatante Mängel, die bislang nicht einmal mit Nachdruck bekämpft werden.
Wenn man schon über eine mehrsprachige Schule nachdenkt, müsste man sich über asymmetrische Modelle (wo die Minderheitensprachen immer überproportional vertreten sind) und über adäquate, effiziente Begleitmaßnahmen Gedanken machen. So könnte man die Mehrsprachigkeit nicht nur kurzfristig fördern, sondern auch langfristig sichern. Das klingt natürlich nicht so sexy, wie der häufig zu vernehmende Ruf nach vollkommener Freiheit im Schulbereich, wird aber der komplexen Situation in unserem Lande wesentlich besser gerecht. Neoliberale Modelle klingen oft sehr schön und einfach, führen aber eher nicht ins erwartete Eldorado.
Übrigens:
- Die italienischen Schulen in Südtirol experimentieren nun schon seit geraumer Zeit mit immersiven Modellen, doch das Fazit aller bislang erhältlichen Erhebungen ist nach wie vor, dass die Zweitsprache an deutschen Schulen besser gelernt wird.
- Schon heute wird in einem angeblich mehrheitlich deutschsprachigen Land wie Südtirol auch von der deutschen »Landesmehrheit« die Staatssprache für die wichtigste gehalten, um hier leben zu können. Bei allen, denen der Erhalt der heutigen Mehrsprachigkeit wirklich am Herzen liegt, sollten eigentlich die Alarmglocken schrillen.
- Zumindest bislang hat das Land keine primäre Zuständigkeit im Schulbereich. Das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung, um etwa im Zusammenhang mit mehrsprachigen Schulmodellen effizientes und sicheres Risikomanagement betreiben zu können.
- Auch ausgewiesene Expertinnen wie Univ. Prof. Rita Franceschini und Annemarie Saxalber weisen — unter anderem — darauf hin, man müsse darauf achten, »dass die Alphabetisierung in der Primarschule, im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, in der Sprache geschieht, die man zu erhalten wünscht — eine Minderheitensprache darf nicht unter Druck geraten.« Es handelt sich hier also nicht um Auslegungen der sogenannten Ewiggestrigen.
Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06 07 || 01 02


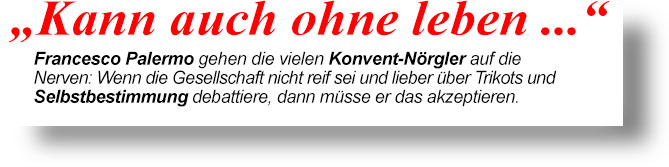

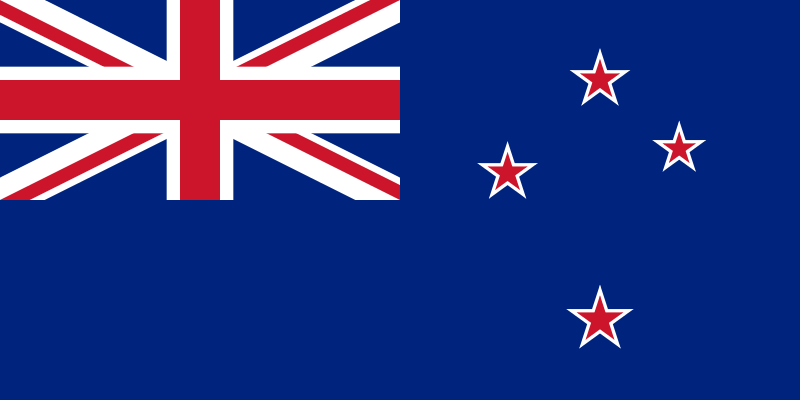
Themen des Südtirolkonvents