Das Netzwerk für Partizipation lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Dialogabend mit Information und Ideenaustausch über den Südtirolkonvent:
La Rete per la Partecipazione invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare a una serata di dialogo con informazioni e scambio di idee sulla Convenzione Sudtirolese:
Konvent-Dialog
Dialogo sulla Convenzione
14. Dezember um 20.00 Uhr
14 dicembre alle ore 20.00
Josefsaal, Kolpinghaus Bozen Bolzano
Der Dialog ist ein Weg zu einer anderen Form des Miteinanders. Ziel dieses Dialoges ist es, gemeinsam ein neues Verständnis für die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Autonomie zu entwickeln, gemeinsam einen Sinn zu entdecken, der über bereits bekannte, schon oft gedachte Gedanken und Konzepte oder festgefahrene Gefühlsreaktionen hinaus geht. Für das Gelingen eines solchen Dialoges sind bestimmte Grundhaltungen notwendig: wirklich zuhören, respektvoll und von Herzen sprechen, Unausgereiftes fragend in der Schwebe halten.
— Netzwerk für Partizipation
Il dialogo è un percorso che ci conduce a nuove forme di interazione. L’obiettivo di questo dialogo è comprendere insieme quali sono le possibilità di sviluppo della nostra autonomia, scoprire un senso comune che supera ciò che è già stato pensato ed immaginato, che va oltre le reazioni emotive che abbiamo ormai assunto come degli automatismi. Affinché questa forma di dialogo si realizzi, è necessario assumere atteggiamenti e comportamenti ben precisi: ascoltarsi davvero, rispettarsi, parlare con il cuore, sospendere il giudizio.
— Rete per la Partecipazione

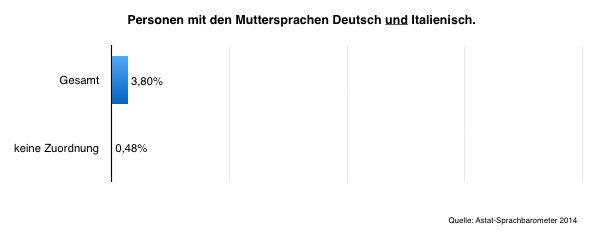
 befürwortet jede Lockerung nationalstaatlicher Bindungen), muss man klar und unmissverständlich festhalten, dass die damit in Verbindung stehenden Ideen in einem demokratischen Entscheidungsgremium unter demokratischen Voraussetzungen ausgefochten werden.
befürwortet jede Lockerung nationalstaatlicher Bindungen), muss man klar und unmissverständlich festhalten, dass die damit in Verbindung stehenden Ideen in einem demokratischen Entscheidungsgremium unter demokratischen Voraussetzungen ausgefochten werden.