Der laufende Südtirolkonvent ruft verschiedenste politische, gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Akteure auf den Plan, die den TeilnehmerInnen ihre Anregungen für die Überarbeitung des Autonomiestatutes zukommen lassen. So ist nun auch ein umfassendes »ladinisches Memorandum« erschienen, das wir hier in voller Länge wiedergeben.
Zu den beiden Verfassern:
- Dr. Lois Trebo ist Schullehrer in Ruhestand, seit den 70er Jahren in ladinischen Kulturvereinen tätig, Autor mehrer Bücher über Volks- und Brauchtum sowie unzähliger Beiträge in der ladinischen Wochenzeitung Usc di Ladins.
- Dr. Erwin Valentini war in den 70er Jahren Universitätsprofessor in Leuven (Flandern) und hat anschließend fast 30 Jahre lang in Luxemburg mit der Europäischen Kommission im Bereich der automatischen Übersetzung in mehreren Sprachen gearbeitet. Ende der 90er Jahre hat er die Leitung des SPELL (Servisc per la planificazion y elaborazion dl lingaz ladin) übernommen und das Projekt 2003 mit der Veröffentlichung von Grammatik und Wörterbuch des Ladin Standard abgeschlossen.
Präambel
Ursachen des Rückgangs der ladinischen Sprache
Die Bedürfnisse der ladinischen Volksgruppe sind weitgehend bekannt, wie auch die Maßnahmen, die dazu geeignet wären, der progressiven Schwächung der ladinischen Sprache entgegenzuwirken. Hier seien einige Ursachen, die für den Rückgang der Sprache verantwortlich sind, erwähnt:
- Zersplitterung Ladiniens in verschiedene politisch-rechtliche Körperschaften: 2 Regionen, 3 Provinzen, 5 Talgemeinschaften; dies trägt zum Auseinanderdriften der ladinischen Täler bei (z.B. Sprachnormierung).
- Es fehlt ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum in Ladinien.
- Unterschiedliche sprachliche, kulturelle und schulische Ausrichtung der ladinischen Täler.
- Sprachpolitische Verselbstständigung der verschiedenen Idiome mit Bildung lokaler Identitäten.
- Es fehlt die politische Anerkennung einer Einheitssprache.
- Großer Einfluss der anderssprachigen Medien und des Verlagswesens.
- Ladinien fehlt, im Gegensatz zu den anderen Volksgruppen, ein sprachliches Hinterland, aus dem es wesentliche Kulturgüter (z.B. Sprach- und Schulmittel, Literatur, Fernsehprogramme, usw.) schöpfen könnte, was vor allem für die Modernisierung und den Ausbau der Sprache nützlich wäre.
- Mangelhafte Präsenz des Ladinischen im öffentlichen Leben und im privatwirtschaftlichen Bereich.
- Zuwanderung Anderssprachiger.
- Abwanderung von Ladinern.
Ein gesamtladinischer Ansatz ist erforderlich
Die ladinischen Täler Val Badia, Gherdëina, Fascia, Fodom mit Col St. Lizia und Anpezo bilden trotz ihrer teilweise unterschiedlichen politischen, sozialen und kulturellen Ausrichtung einen einheitlichen Kultur- und Sprachraum. Die Erhaltung und Förderung der ladinischen Sprache und Kultur verlangt deshalb grundsätzlich einen ganzheitlichen Ansatz; Teillösungen, wenn sie nicht Teil eines ganzheitlichen Förderungskonzeptes sind, sind sogar dazu geeignet, die bestehende Zersplitterung zu verstärken und somit den Zusammenhalt Ladiniens zu gefährden. Die ladinische Kulturpolitik muss deshalb danach streben, einen weitgehend einheitlichen rechtlichen Rahmen für alle ladinischen Täler zu schaffen, als Voraussetzung für eine einheitliche Handhabung der Rechte und Bedürfnisse der ladinischen Volksgruppe. Die statutarischen Rechte der Ladiner Südtirols (Badia und Gherdëina) und des Trentino (Fascia) sollen langfristig vereinheitlicht und den Ladinern Venetiens (Fodom, Col St. Lizia und Anpezo) zuerkannt werden. Dies könnte gewährleistet werden, wenn die drei ladinischen Gemeinden Venetiens an Südtirol angeschlossen würden. Die Wiedervereinigung ist eine Grundforderung, die die ladinische Bevölkerung in den entscheidenden Momenten ihrer Geschichte erhoben hat:
- 1918: Forderung des Selbstbestimmungsrechts durch die ladinischen Bürgermeister;
- 1946: Kundgebung auf dem Sellajoch gegen die Zersplitterung und für die Wiedervereinigung der Ladiner;
- 2007: Referendum in den ladinischen Gemeinden Venetiens für deren Anschluss an Südtirol.
Diese historische Forderung umzusetzen, sollte eine vorrangige Aufgabe der Politik und insbesondere der Lia di Comuns Ladins (Verband der ladinischen Gemeinden) sein.
Rechte, Forderungen, Bedürfnisse
Es muss klar unterschieden werden, welche Rechte den Ladinern laut Gesetz (Verfassung, Autonomiestatut, Durchführungsbestimmungen, etc.) zustehen und welche Forderungen sich aus dem allgemeinen Prinzip der Gleichstellung der drei Sprachgruppen und des Schutzes der Sprachminderheiten ergeben. Was die gesetzlich verankerten Rechte betrifft, soll deren Umsetzung eingefordert werden, wenn nötig mit gerichtlicher Hilfe; Förderungsmaßnahmen zugunsten von Sprache und Kultur sollen in Rahmen des politischen Dialogs zwischen Minderheit und Mehrheit beantragt und konkretisiert werden. Seitens der Politik werden jedoch nicht nur Ankündigungen von allgemeinen Grundsätzen und guten Absichten erwartet, diese müssen auch in die Tat umgesetzt werden. Die Bedürfnisse der ladinischen Minderheit dürfen nicht nach einem rein numerischen Proporz gemessen werden, sie sind teilweise anders und verhältnismäßig viel größer als diejenigen der anderen zwei Volksgruppen in Südtirol. Übrigens gilt das Prinzip, dass eine Demokratie danach bewertet wird, wie sie mit den Bedürfnissen ihrer Minderheiten umgeht.
A. Politische Maßnahmen zugunsten der Ladiner
A.1 Gesamtladinien
- Die autonomen Länder Südtirol und Trentino und die Region Venetien sollen sich in Rom für den Wiederanschluss der drei ladinischen Gemeinden von Belluno an Südtirol stärker einsetzen; der im Jahre 2007 bei einer Volksabstimmung in den drei Gemeinden bekundete Wille (über 80% für den Anschluss) darf nicht ignoriert werden; das 1923 von den Faschisten begangene Unrecht der Aufteilung der Ladiner soll endlich aus der Welt geschafft werden; das Thema müsste in Rom zur Sprache gebracht und auf die Tagesordnung des Parlamentes gesetzt werden.
- Im Rahmen der laufenden Parlamentsreform bzw. der Wahlgesetze und des Autonomiestatutes soll die Errichtung eigener Wahlkreise für die 18 Gemeinden und 3 Ortschaften des ladinischen Territoriums angestrebt werden.
- Die autonomen Länder Südtirol und Trentino und die Region Venetien sollen gesamtladinische Initiativen und Organisationen fördern und eine Infrastruktur schaffen, die zu einer breiteren Zusammenarbeit zwischen den Tälern und zu einer Stärkung der politischen und kulturellen Einheit Ladiniens führen können.
- Die Lia di Comuns Ladins soll mit konkreten Befugnissen und Mitteln ausgestattet werden. Sie soll sich dafür einsetzen, dass den Ladinern aller Täler die gleichen Rechte zuerkannt werden.
- Die autonomen Länder Südtirol und Trentino und die Region Venetien sollen die Union Generela di Ladins dla Dolomites als kulturelle Vertreterin aller Dolomitenladiner im Sinne des Art.3.1. des Minderheitenschutzgesetzes 482/1999 und auch als Ansprechpartnerin der Lia di Comuns Ladins anerkennen, nach dem Muster der Lia Rumantscha in Graubünden.
- Die ladinischen Passstraßen sollen durch bauliche Maßnahmen so gesichert werden, dass sie das ganze Jahr befahrbar sind. Die Einführung einer allgemeinen Maut oder anderer Verkehrsbeschränkungen führt nur zu einer zusätzlichen gegenseitigen Abschottung der ladinischen Täler und der Ladiner.
Liej inant / Weiterlesen / Continua →

 hatte den A. Adige schon mehrmals für seine
hatte den A. Adige schon mehrmals für seine 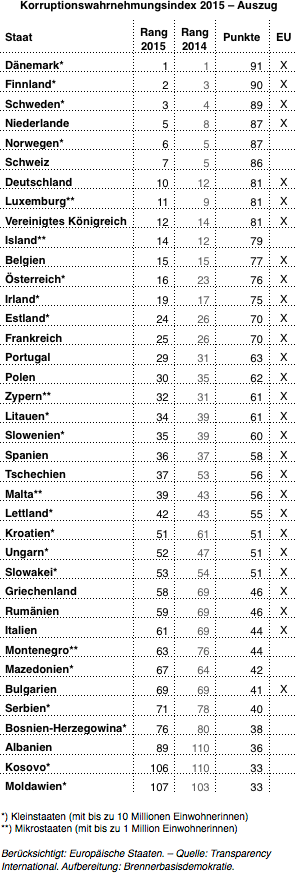

»Vorschläge für ein politisch-kulturelles Programm zugunsten der ladinischen Volksgruppe«