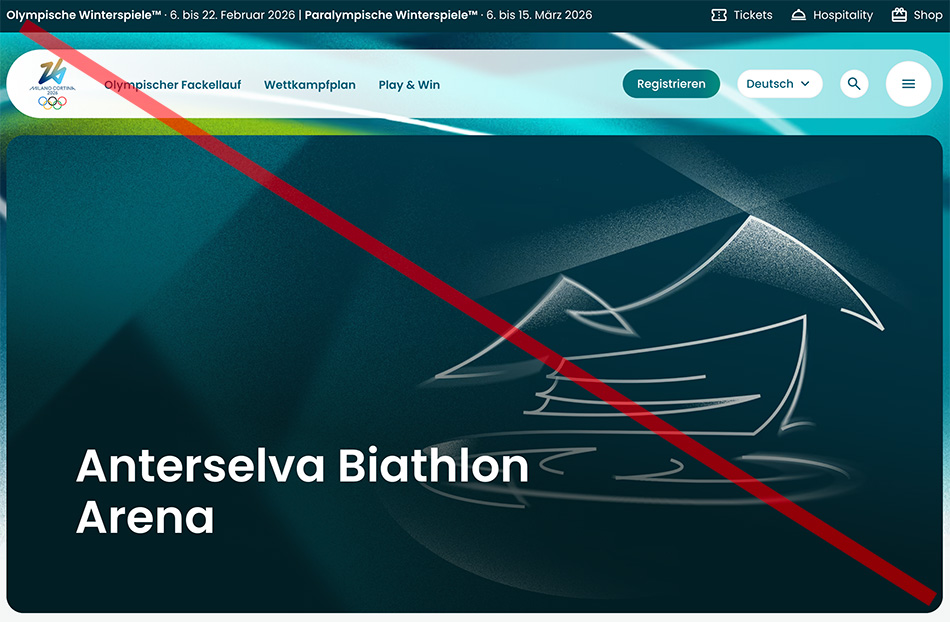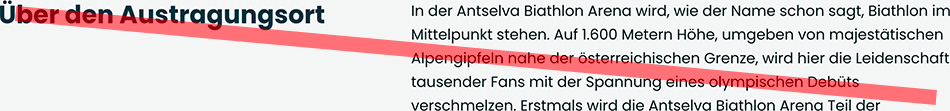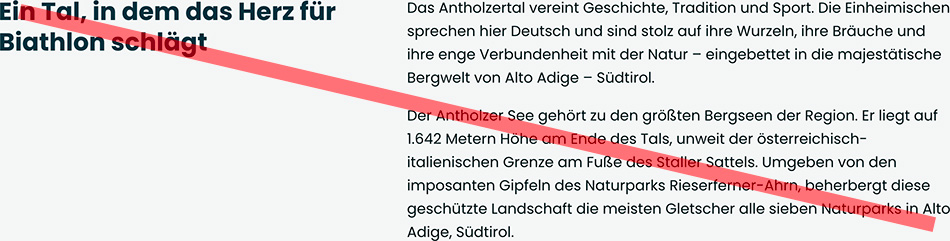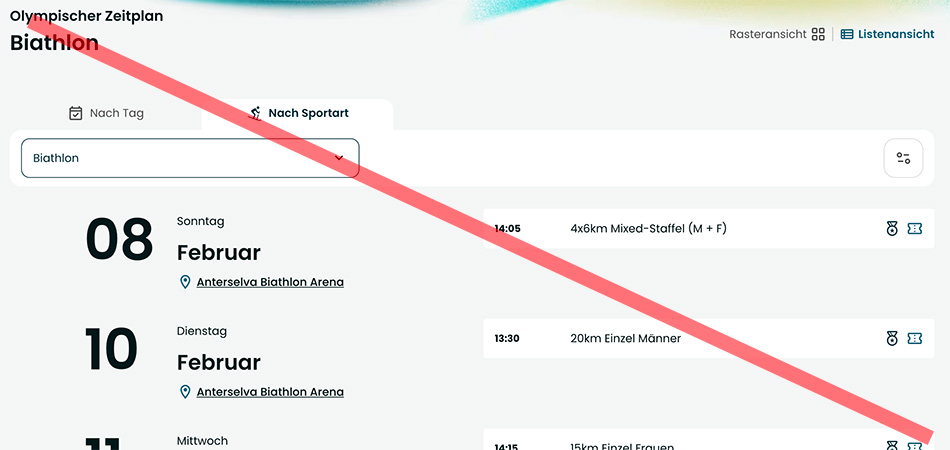Die nationalistischen Dynamiken verkennend, die mit einem solchen Großereignis einher gehen, hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) im Jahr 2019 behauptet, wir könnten dank Olympischer Spiele im Schlepptau von Mailand und Anpezo die weltweite Aufmerksamkeit nutzen und die Besonderheiten Südtirols aufzeigen.
Bislang ist erwartungsgemäß das Gegenteil eingetreten, nämlich eine weitere Unterordnung gegenüber Italien und nationaler Symbolik. Und die Besonderheit, die wir international präsentieren und verfestigen, ist die eines kolonialen Verhältnisses, das Eigenheiten negiert und unsichtbar macht, wo immer es geht.
Gestern haben die Schützen in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass Antholz mit seiner Biathlon-Arena auf der offiziellen Website olympics.com mit dem faschistisch oktroyierten, kolonialen Ortsnamen dargestellt wird. Um jedoch genau zu sein, hatte zuvor — hier in den Kommentaren — Werner Pramstrahler schon am 14. Jänner auf ebendiese Tatsache aufmerksam gemacht.
Tatsächlich wird die Sporteinrichtung als Ganzes ausschließlich mit dem zum Zwecke der Entnationalisierung erfundenen Ortsnamen betitelt, und zwar selbst in der deutschen Sprachversion, geschweige denn in den zahlreichen anderen.
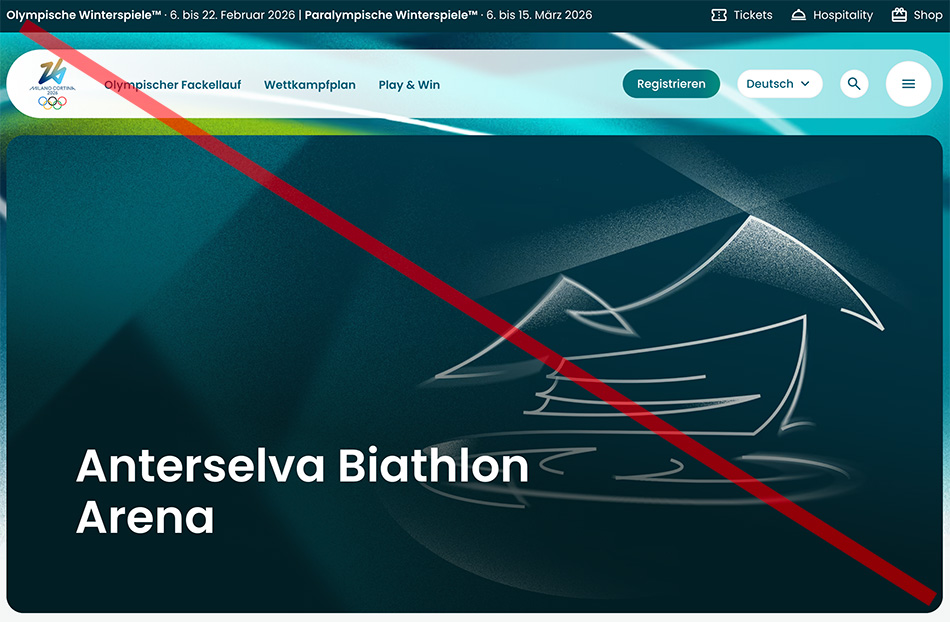
Website olympics.com (Ausschnitt) – Querbalken von mir
Dies geschieht nicht nur im Titel, sondern zieht sich auch durch die Beschreibung:
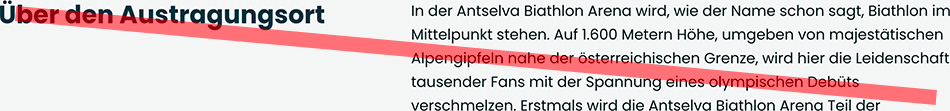
Website olympics.com (Ausschnitt) – Querbalken von mir
Darüber hinaus wird auch Südtirol mit der kolonialen italienischen Landesbezeichnung tituliert, während der deutsche Name — wiederum selbst im deutschen Text — nur nachgereiht ist:
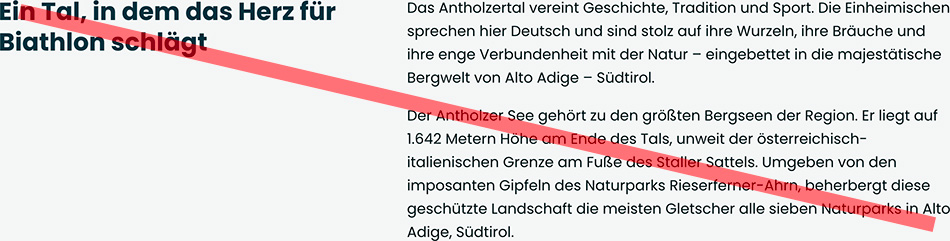
Website olympics.com (Ausschnitt) – Querbalken von mir
Wie schon Werner Pramstrahler in seinem Kommentar hingewiesen hat, werden Sprache, Geschichte und Bräuche lediglich als folkloristisches Beiwerk dargestellt.
In jenen Abschnitten der Seite schließlich, die wie der Veranstaltungskalender nicht speziell Antholz gewidmet sind, scheint Antholz dann überhaupt nicht mehr auf, da nur noch der italianisierte Name der Arena relevant ist:
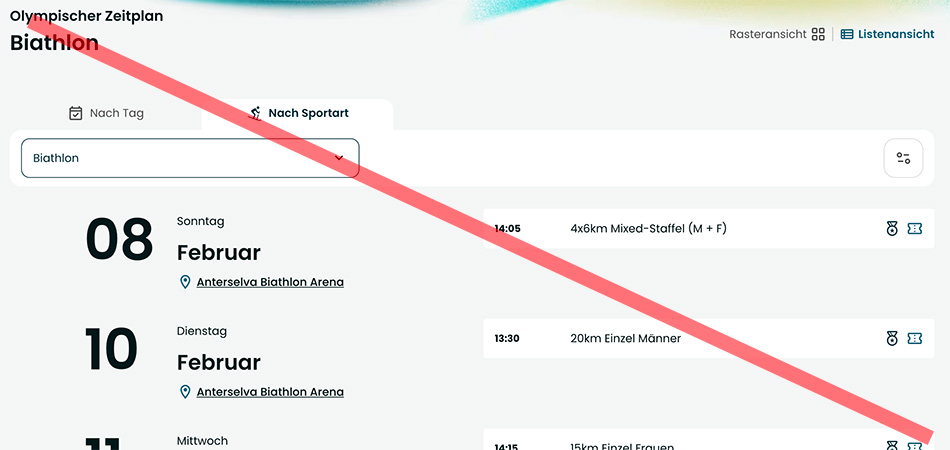
Website olympics.com (Ausschnitt) – Querbalken von mir
Die Landesregierung hat Südtirol zum Anhängsel einer italienischen Veranstaltung — die Olympischen Spiele trägt Italien aus — gemacht, ohne die Bevölkerung zu befragen. Zudem war sie anders als angekündigt unfähig, die Besonderheiten unseres Landes in den Vordergrund zu stellen, sondern setzt Südtirol vielmehr einer weiteren sprachlich-kulturellen Demütigung auf internationalem Parkett aus.
Für eine Kurskorrektur ist zwar noch etwas Zeit, doch selbst damit würde man nur noch Schadensbegrenzung betreiben und jedenfalls keine selbstbewusste Darstellung als ein Land erreichen, das sich vom Rest des italienischen Staatsgebiets unterscheidet.
Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06 || 01