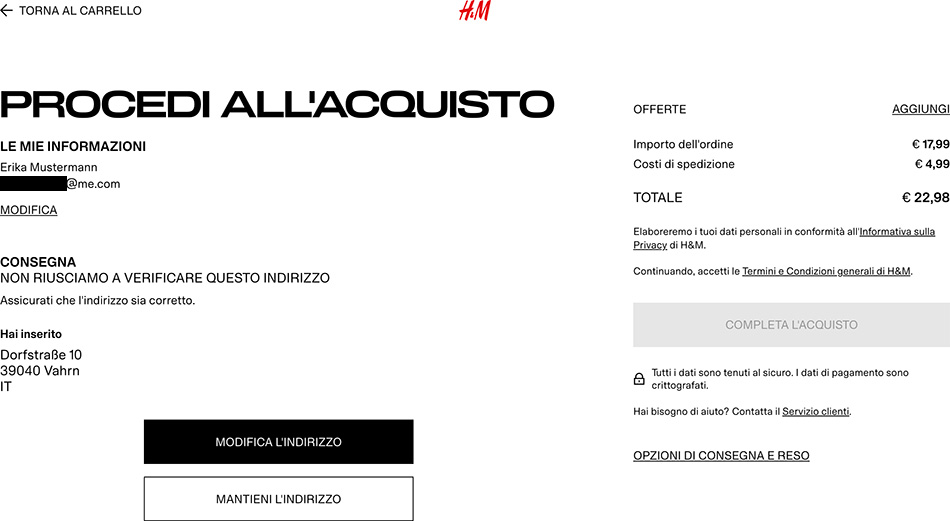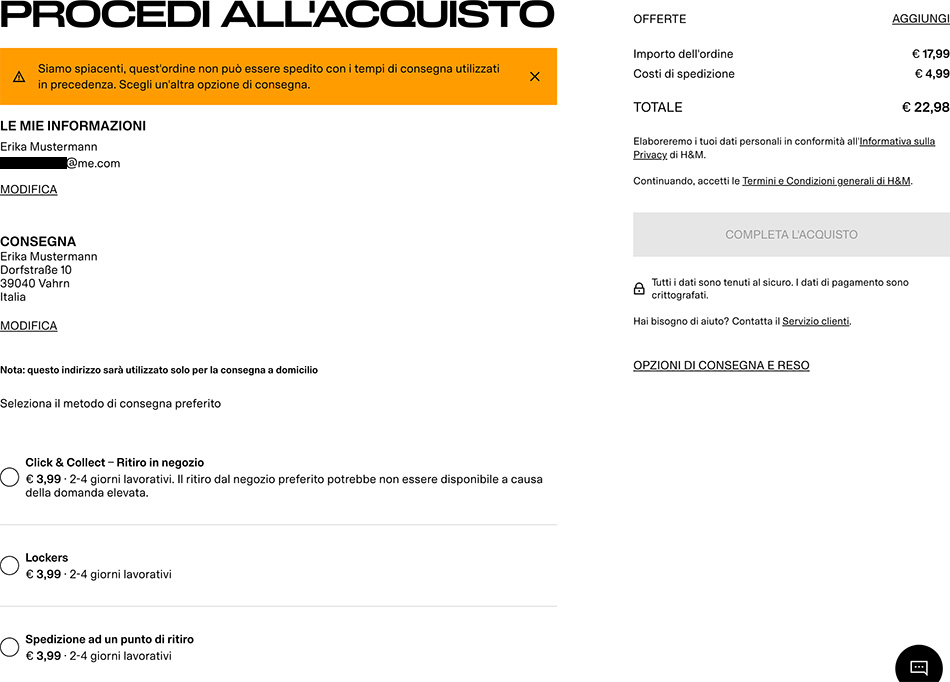Wo bleibt die Aufregung wegen des Abschlachtens in Darfur?
Fast täglich demonstrieren die Freunde der Hamas gegen Israel, gegen die angeblichen Kindermörder, gegen den angeblichen Genozid in Gaza.
Die Hamas-Sympathisanten im Westen mischen inzwischen überall mit, in der Umweltbewegung, auf queeren Veranstaltungen, stören Diskussionen an Universitäten, pöbeln auf Straßen und Plätzen Nicht-Demonstranten an.
Keine Frage, der israelische Krieg gegen die Bevölkerung von Gaza ist kriegsverbrecherisch. Die Freunde der Hamas blenden die Massaker vom 7. Oktober 2023 gar nicht beschämt aus. Die Opfer, Mädchen, Frauen, Kinder, junge und alte Männer, die meisten Anhänger der israelischen Friedensbewegung, wurden von den islamo-faschistischen Killern bestialisch ermordet.
Darüber wird geschwiegen. Manche sehen in diesem 7. Oktober gar eine Befreiungsaktion gegen die israelischen Besatzer. Gaza war aber nicht israelisch besetzt. Wie verblendet muss man sein, drastischer, wie krank muss man sein!
Die Pro-Hamas-Sympathisanten, hysterisch und mit antisemitischem Schaum vor dem Mund, forderten 2024 auf einer Kundgebung in Hamburg gar die Errichtung eines Kalifats. Der Islamische Staat IS praktizierte einige Monate lang das Kalifat zwischen Syrien und dem Irak.
Tausende Tote waren die Folge dieses Experiments. Tausende Mädchen und Frauen wurden vergewaltigt und in die Emirate als Sklavinnen verkauft. Die IS-»Kämpfer«, gar viele aus Westeuropa, fielen im August 2014 über die Jesiden her. Eine Befreiung der besonderen Art.
Von der Hamas zu den RSF
Die geistigen Brüder der Hamas, die sudanesischen Rapid Support Forces, schlachten derzeit im westsudanesischen Darfur wahllos Menschen ab. Als großzügige Sponsoren gelten die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Russland »engagiert« sich mit seinen Söldnern an der Seite der RSF-Massenmörder. Laut der deutschen Tageszeitung taz geht es im Kampf in Darfur um Gold, Vieh und Boden.
Ins Visier der RSF gerieten die nicht-arabischen Bevölkerungen des Sudans, besonders Darfur. Die RSF hantieren mit Massenerschießungen und Massenvergewaltigungen, »Instrumente« der »ethnischen Säuberung«. Die RSF sind beeindruckend effizient und erfolgreich: Mehr als 150.000 Menschen sollen von diesen islamistischen Milizionären bereits ermordet worden sein, zwölf Millionen Menschen flüchteten vor den Killern mit dem Koran in der Hand, 25 Millionen Menschen hungern.
In Darfur findet wieder ein Genozid statt, ja, ein GENOZID! Wie schon 2003. Damals hießen die massenmordenden »Akteure« abenteuerlich Dschandschawid, »berittene Teufel«. Der sudanesischen Zentralstaat rüstete diese »Reiter« in den 1980er Jahren im Kampf gegen die schwarzafrikanische südsudanesische Volksbefreiungsbewegung kräftig auf.
Die Dschandschawid, sie ziehen wie einst die SS in Osteuropa plündernd und marodierend durch Darfur, schlachteten damals mehr als 300.000 Darfuris ab. Tausende Mädchen und Frauen wurden vergewaltigt, mehr als 2,5 Millionen flüchteten aus ihrer Heimat. Ein Genozid, wie Genocide Alert versucht aufzuklären.
Die Proteste dagegen waren verhalten, überschaubar, nur wenige Demonstranten protestierten gegen den Völkermord in Darfur. Der Internationale Strafgerichtshof kam gar nicht auf die Idee, gegen die Milizionäre Anklage wegen Völkermords zu erheben.
Zweimal Genozid in Darfur
Und jetzt wiederholt sich diese Geschichte. Ein Höchstmaß an entgrenzter Gewalt fegt durch das Land, eine Gewalt, die auch von der EU alimentiert wurde. Die RSF-Truppen erhielten als »Grenzschützer« Brüsseler Euros. Sie sollten die »Weiterreise« von Migranten und Flüchtlingen aus der Sahelzone unterbinden. Ein fragwürdiger Pakt, analysierte Spiegel Online 2018 diese Kooperation zwischen der EU und den Gewalttätern von der RSF.
Zurecht die Kritik, wo bleibt der Protest im Westen? Wo sind die Aufgebrachten, die sich gegen dieses Massenmorden wenden?
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) dokumentiert seit Jahren die Kriegsverbrechen der RSF-Milizen, 2024 belegte HRW die »ethnischen Säuberungen«. Die New York Times schlug publizistisch Alarm, die Welt scheint nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, den Genozid zu stoppen.
Ein Versuch einer Erklärung: Hier massakrieren nicht Israels — also Juden — ihre arabischen Nachbarn, sondern muslimische Araber ihre nicht-arabischen Nachbarn. Klartext, der Antisemitismus heizt den Protest gegen den israelischen Krieg in Gaza an, der Antisemitismus ist der Brandbeschleuniger für die weltweiten antiisraelischen und antijüdischen Demonstrationen. Diese schweigen zu Darfur, wie eben Schafe und Lämmer.
Während Hamas-Kundgebungen von vielen tausenden Demonstranten unterstützt werden, bleiben und blieben Solidaritätskundgebungen für Darfur überschaubar. Wie letzthin in Berlin vor dem deutschen Außenministerium. Mit einer Mahnwache versuchte die Salam Sudan Campaign, ein Bündnis sudanesischer Initiativen, auf die Gräueltaten der RSF aufmerksam zu machen. Nur die Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker unterstützte die Aktion.
Die Darfuris bleiben sich selbst überlassen, werden im Stich gelassen. Obwohl die Gräuel in Darfur die Gräuel in Gaza bei weitem übertreffen, obwohl in Darfur tatsächlich ein Genozid stattfindet.
Das Bündnis der Schweigenden reicht vom demokratischen Westen, über die UNO, dem Internationalen Strafgerichtshof bis hin zu den antiisraelischen Hassern, die seit Monaten den angeblichen Völkermord in Gaza anprangern. Auch in Bozen. Pharisäer unter sich.
Cëla enghe:
Autor:innen- und Gastbeiträge spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung oder die Position von BBD wieder, so wie die jeweiligen Verfasser:innen nicht notwendigerweise die Ziele von BBD unterstützen.· I contributi esterni non necessariamente riflettono le opinioni o la posizione di BBD, come a loro volta le autrici/gli autori non necessariamente condividono gli obiettivi di BBD. — ©